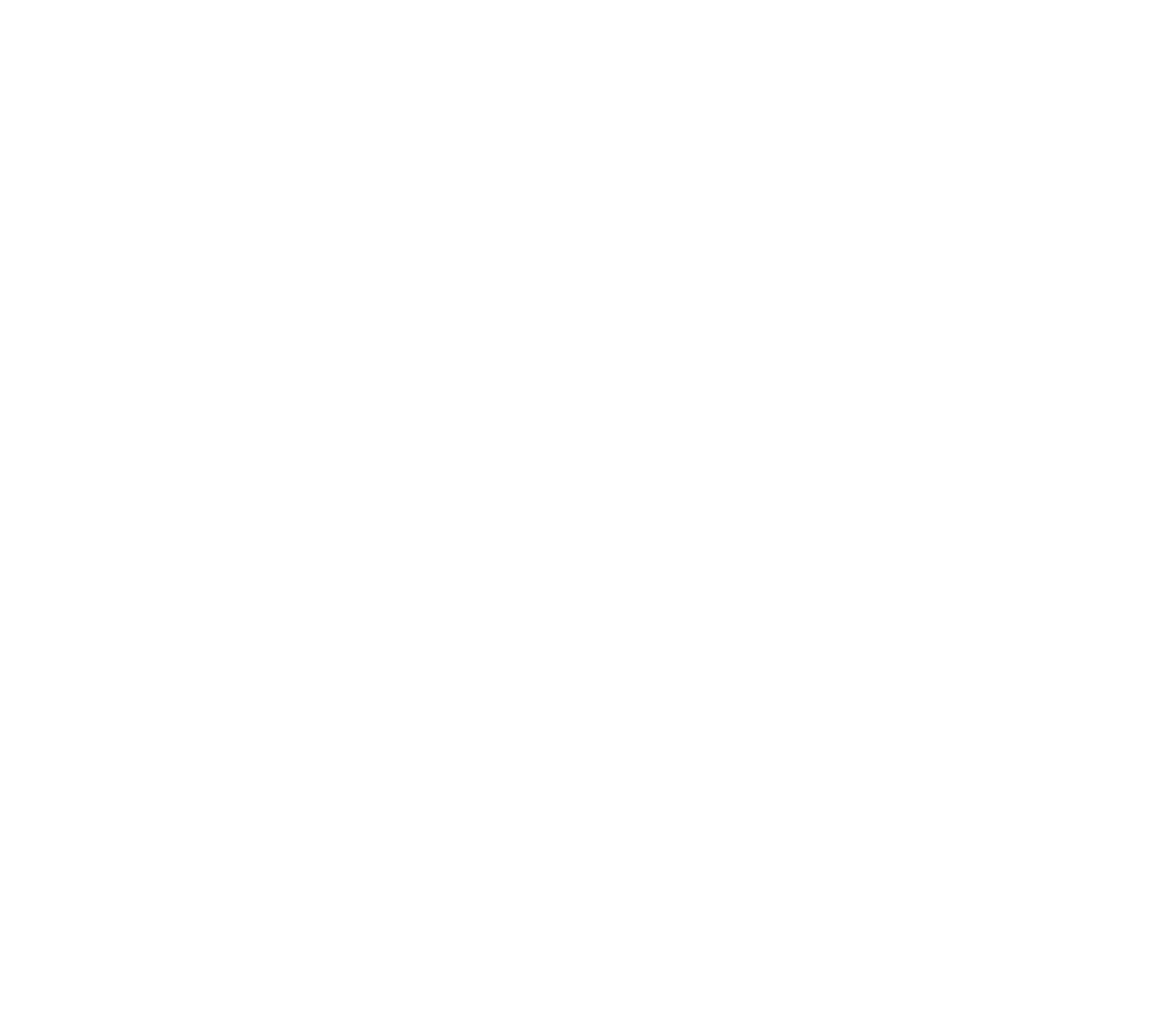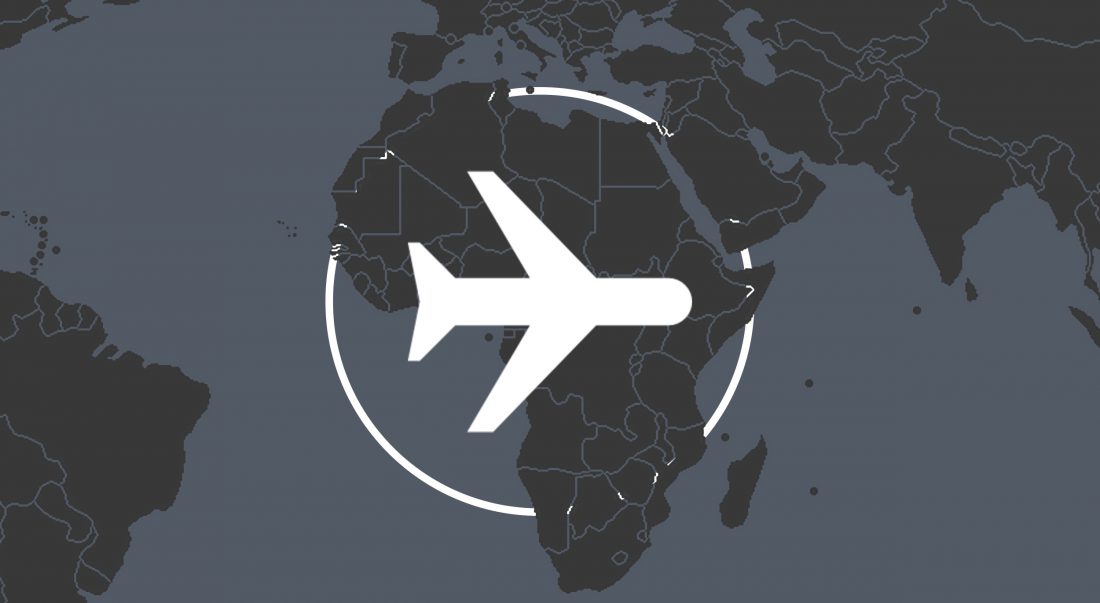Schreiben im Flugmodus
Ich bin auf dem Weg und sitze am Flughafen. Das erste, womit ich auf meiner Reise beginnen möchte, ist, mich frei zu schreiben. Sobald ich mein Blog öffne, einen neuen Artikel anlege und dann anfange zu tippen, kommt entweder Stumpfsinn dabei rum oder ich verliere bereits nach wenigen Minuten die Lust daran. Das mag daran liegen, dass dem Schreiben durch die Veröffentlichung auf einer Art offizieller Seite unmittelbar ein direkter Zweck zugeschrieben wird. Ich weiß, dass alle es lesen können, ich gebe mir Mühe, dem Publikum zu gefallen und ich denke viel zu lange über jeden einzelnen Satz nach. Früher habe ich meine Texte immer in einem Texteditor geschrieben. Dort wird nichts umgebrochen, es wird nichts autokorrigiert und meine Gedanken werden nicht gleich in irgendein Format gequetscht. Es geht dann beim Schreiben auch noch gar nicht darum, wer den Text lesen soll oder wird, sondern nur darum, dass ich mir meine eigenen Gedanken vergegenwärtige – quasi visuell reflektiere. Es gibt Situationen im Leben, die man durchlebt aber erst akzeptieren oder genießen kann, wenn man sie seinem besten Freund, seiner besten Freundin, einem seiner Elternteile oder einer sonstigen vertrauten Person erzählt hat. Das Erlebte oder der Gedanke werden erst dann real. Jetzt gerade, in diesem Moment des Schreibens, bin ich selbst meine vertraute Person. Ich erzähle es einmal aktiv mir selbst und kann eine ganz neue Perspektive einnehmen, einen ganz neuen Gedanken dazu haben. Es ist wie eine Konversation, ein Monolog, der mich auf neue Ideen, anknüpfende Erkenntnisse und wieder weiterführende Monologe bringt.
Wir alle führen Monologe in unserem Kopf. Doch sie nieder zu schreiben, gleicht einem Dialog, den man mit einer vergangenen Version seiner Selbst führt. Der geschriebene Gedanke verliert im Moment des Schreibens an Aktualität allein deshalb, weil man ihn während des Schreibens im Kopf weiterdenkt und ihm etwas neues hinzufügt.
Wenn man etwas weder tun noch bloß darüber nachdenken will, kann man es aufschreiben und man wird dem Tun, den Gründen es zu tun oder nicht zu tun, dem Ergebnis, das man erwartet oder nicht erwartet, oder dem Ding selbst viel näher kommen – allein, weil man es in die reale Welt holt, es festhält. Denken ist ja von Natur aus irgendwie passiv. Durch das Schreiben aber erzeugen wir einen realen aktiven Output. Wir »veröffentlichen« den Gedanken, machen ihn für andere zugänglich – und das weitaus nachhaltiger und reflektierter als bei einer Erzählung. Das, was wir niederschreiben, durchläuft eine Art von Filter – manches einen grob- manches einen engmaschigeren.
Vielleicht ist der Vergleich zu einem Prisma angebracht. Gedanken wären dann das Licht, das auf der einen Seite einfällt und aus der Stiftspitze oder der Tastaturcursor in gebündelter Form wieder austritt. Wie rein dieses Licht ist oder wie oft es durch Korrekturen gebrochen oder gebogen wird, kommt auf den Schreibenden und den Lesenden an. Das Licht scheint mir nebenbei gesagt eine sehr schöne Metapher für einen Gedanken zu sein – ist es doch ebenso flüchtig und ungreifbar, kann es doch verschiedene Intensitäten annehmen, je nach Perspektive und Umgebung anders gesehen oder interpretiert werden und schließlich einfach im Schatten verschwinden. Wie sinnvoll der Begriff »Erleuchtung« in diesem Zusammenhang doch scheint…
So gesehen tappt jeder von uns in einer Dunkelheit, die wir nur durch unsere Gedanken erleuchten und erschließen können. Alles in unserer Welt, das wir sehen ist physisch gesehen nur Licht. Könnte man weitergehend metaphorisch also sagen, dass alles, was wir sehen, nur Gedanken sind? Ist das größte Licht, die Sonne also der einzig große und wahre Gedanke – eine alles durchdringende Idee?
Ich weiß, dass diese Gedanken im Rahmen eines »Reiseberichtes« deutlich zu weit führen. Ich frage mich selbst, wie ich von der Bedeutung des Schreibens zur Hinterfragung unserer Existenz gekommen bin. Ich denke aber, dass es eben dies ist, was mir gefehlt hat. Mich beim Schreiben von meinen Gedanken treiben zu lassen und mir einen Satz mit dem nächsten zu beantworten, ohne je eine Frage gestellt zu haben.
Mein einziges Problem mit diesen freien Texten ist, dass ich sie am Ende meistens doch teilen möchte – und wenn es nur ist, um »mein Licht« mit anderen Menschen zu teilen und einen metaphorischen Regenbogen zu erzeugen. Vielleicht suche ich eben dies: dass diese Gedanken bei einem Lesenden, der sich in einem mentalen medienüberfluteten Dauerregen zu befinden glaubt, für einen kurzen Moment einen Regenbogen sieht. Ich möchte weder großkotzig behaupten, ich könnte gedankliche Regenbögen erzeugen, noch in einem textlichen Happy-End-Finale schließen. Es ist eben einfach so aus mir herausgesprudelt und da kommt dann eben manchmal auch philosophisches Konfetti bei herum – sollte ich diesen Text veröffentlichen und euch die gedankliche Einhorn-Kotze nicht gefallen, lest was anderes. Hier wird jetzt mal gegessen, was auf den Tisch kommt!
Ich wollte hier im Terminal sitzend mit einem Reisebericht anfangen. Ich habe faktisch noch nichts weiter beschrieben, als dass ich am Flughafen sitze. Und doch habe ich umso mehr das Gefühl, mich mitten in einem berauschenden euphorischen Beginn einer Reise zu befinden – einer ehrlichen, ungeschminkten und ungewissen Reise.