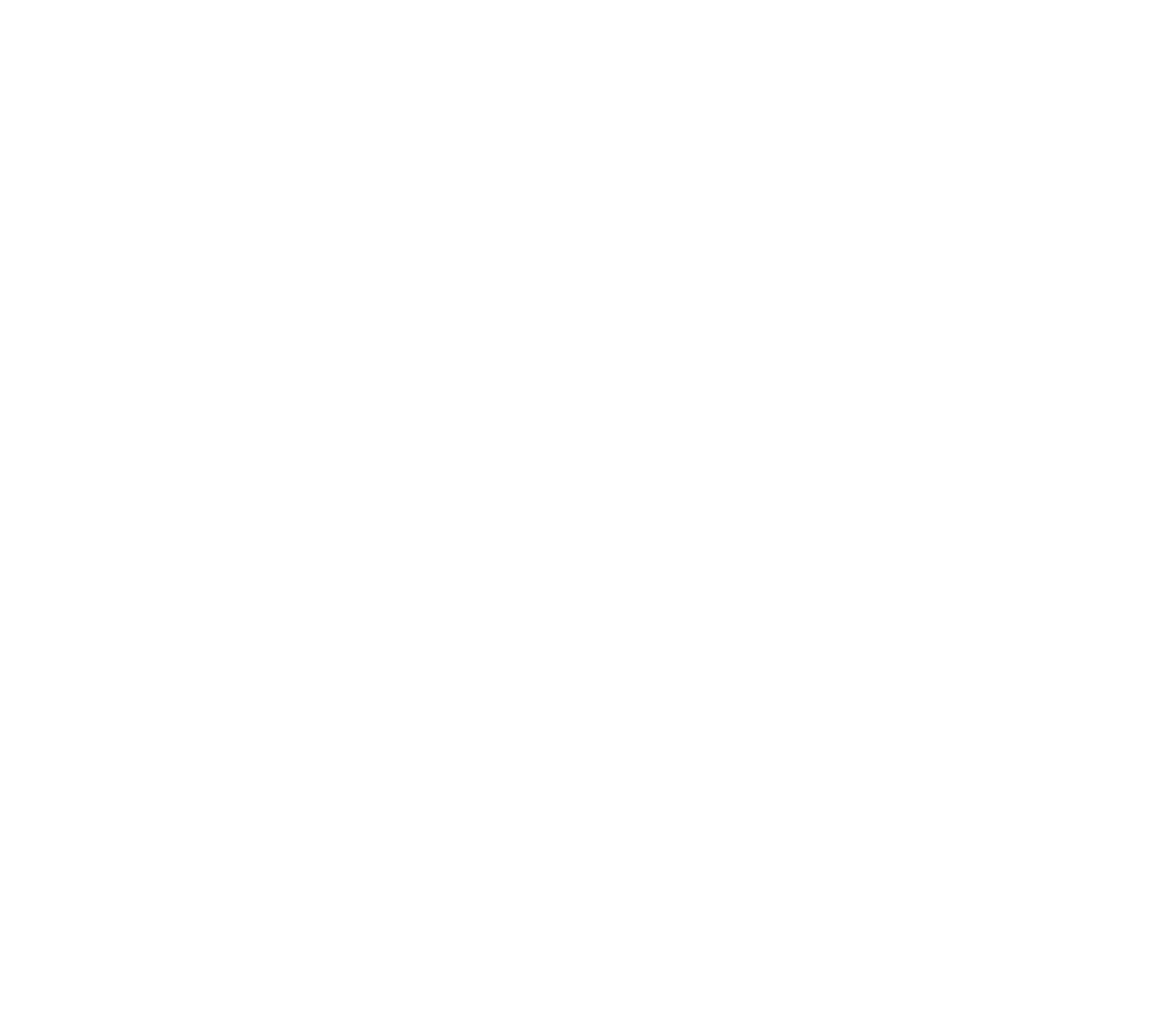Die Komfort-Hütte oder warum ein Blick aus dem Fenster nicht reicht
Bei dem ein oder anderen etwas schärferen Text, den ich derzeitig mal schreibe, mag man vielleicht das Gefühl bekommen, dass ich eine oppositionelle Position gegenüber allem Gewohnten einnehme, voll auf dem Anti-Alles-Trip bin. Das ist so einfach allerdings nicht zu sagen. Zu sagen ist, dass ich derzeitig den wohl größten Abstand zu meinem alltäglichen Leben und meinen Gewohnheiten eingenommen habe, den ich je hatte.
Es ist ein wenig wie aus einem Haus heraus zu treten, in dem man zwar täglich wohnt, das man aber nie verlässt, geschweige denn von außen in Augenschein nehmen kann. Wir bleiben in unseren geschützten vier Wänden, weil es warm ist und trocken und – wie könnte es anders sein – sicher. Wir leben so vor uns da hin, folgen unserer Routine, schauen vielleicht auch mal aus dem Fenster, wenn wir eines haben, und öffnen es als höchstes der Gefühle vielleicht auch, um einen Lufthauch zu erhaschen. Wir könnten natürlich hinausgehen und atmen und die Sonne und den Wind auf unserer Haut spüren, all die guten Gerüche und Geräusche erleben und vielleicht auch den Garten verlassen, wenn wir denn wissen, was ein Garten ist und einen haben. Aber das wäre viel zu gefährlich, denn man weiß ja nicht, was sonst noch alles passieren kann da draußen und schließlich geht es uns ja auch eigentlich gut so wie es ist. Jeder, der das jetzt so liest, würde sagen: Natürlich verlasse ich mein Haus, das mache ich tagtäglich. Aber natürlich geht es nicht wirklich um ein Haus, nein, ich spreche von unserer allzu oft beschriebenem und allgemein kritisierten Komfortzone. Und diese verlassen wirklich die allerwenigsten von uns. Ich meine, natürlich ist sie nichts Schlimmes und sie gefällt uns, sonst hätte sie nicht ihren Namen. Und auch ich habe eine – jeder hat sie. Sie kann in den unterschiedlichsten Formen auftreten: Sie kann das Zuhause sein mit all seinen Facetten, die Nachbarschaft, die Arbeit, zu der viele täglich gehen, vielleicht auch einfach das Badezimmer in seiner gewohnten Form, ein warmes weiches Bett, das Smartphone, die gewohnten Menschen, Familie und Freunde, die alltäglichen Gewohnheiten, finanzielle Sicherheit oder sogar das Wetter. Sie ist das, womit wir in unserem Alltag gezielt umgeben.
Doch wenn man sich das Sinnbild des Hauses noch einmal vor Augen hält – ein Mensch und sein kleines angenehmes zu Hause –, würde man wohl immer sagen: »Warum verlässt die Nase nicht das Haus? Es ist doch so viel schöner im Garten und bei den Nachbarn und gegenüber in der Bar und in der gesamten bunten Welt um sein Haus herum!« Nun, die »Nase« ist eben bequem und vermeidet Unannehmlichkeiten. Vorsicht ist schließlich besser als Nachsicht. Man könnte draußen hinfallen, angegriffen werden oder sogar sterben. Fakt ist, dass man das in seinem Haus früher oder später auch tut und Nachsicht kann ja manchmal auch als reizvollen Lehre auftreten.
Doch worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass wir uns nicht nur viele interessante Erfahrungen draußen in der Welt nehmen, wir nehmen uns auch den Blick auf unser eigenes Haus. So sehen wir nicht, wie es beschaffen ist, welche Farbe es hat oder wo es sich überhaupt befindet. Das Reisen gibt uns die Möglichkeit, unsere Komfortzone zu verlassen und einen objektiveren Blick von außen auf uns selbst und unser ganzes eigenes Leben zu gewinnen. Wir lernen Dinge über unser eigenes Leben, weil wir so viele neue Versionen eben jenes kennenlernen und wir lernen so einiges über uns selbst, einfach weil wir uns in einem ganz neuen Umfeld, in einem ganz neuem Licht sehen. Wenn es in unserem Haus mal stürmisch wäre oder geregnet hätte, hätten wir immer die Tropfen mit einem Eimer aufgefangen und so das Problem weitestgehend behoben. Nun aber können wir sehen, dass der Wind die Dachziegeln vom Dach gerissen hat und es jedes Mal hineinregnet. Durch unseren Blick von außen gewinnen wir einen ganz neue Perspektive auf das Problem und können es vielleicht beheben.
Man muss sicherlich nicht ans andere Ende der Welt reisen, um seine Komfortzone zu verlassen oder genügend Abstand dazu zu gewinnen. Was ist schon genügend Abstand? Entscheidend ist, dass man es sich mal bewusst »ungemütlich« macht, sich Extremsituationen aussetzt, sich in eine Situation begibt, in der man gefordert wird und unter Umständen alleine klarkommen muss. Es geht darum, über sich hinauszuwachsen. Um dies wörtlich zu nehmen eine weitere letzte Metapher: Es fühlt sich vielleicht ein wenig an wie eine Blume zu sein, die man aus einem kleinen Topf in der Ecke eines stinkigen dunklen Zimmers genommen und draußen an einem schönen Fleckchen in die Erde gepflanzt hat. Versteht mich nicht falsch, mein Leben ist kein stinkiges, dunkles Zimmer. Aber der Effekt, den das Reisen auf mich hat ist einfach ein sehr extremer. Ich kann atmen, ich kann meine Wurzeln ausstrecken und wandern wohin immer ich will und mich der Sonne entgegen recken, wachsen bis in den Himmel und erblühen in vollster Blüte, Kraft und Energie. Ich weiß, dass dieser Satz wahrscheinlich kleine Schleimfäden zwischen den Synapsen eurer literarischen Gehirnwindungen zieht, doch er drückt genau das aus, was ich erlebe. Ich möchte euch also ermutigen, aus eurer kuschligen kleinen Hütte heraus zu treten, die Tür hinter euch zuzuschlagen, die Welt zu erkunden, in der ihr euch befindet, euch selbst zu erkunden und schließlich zu wachsen, wohin immer ihr wollt.