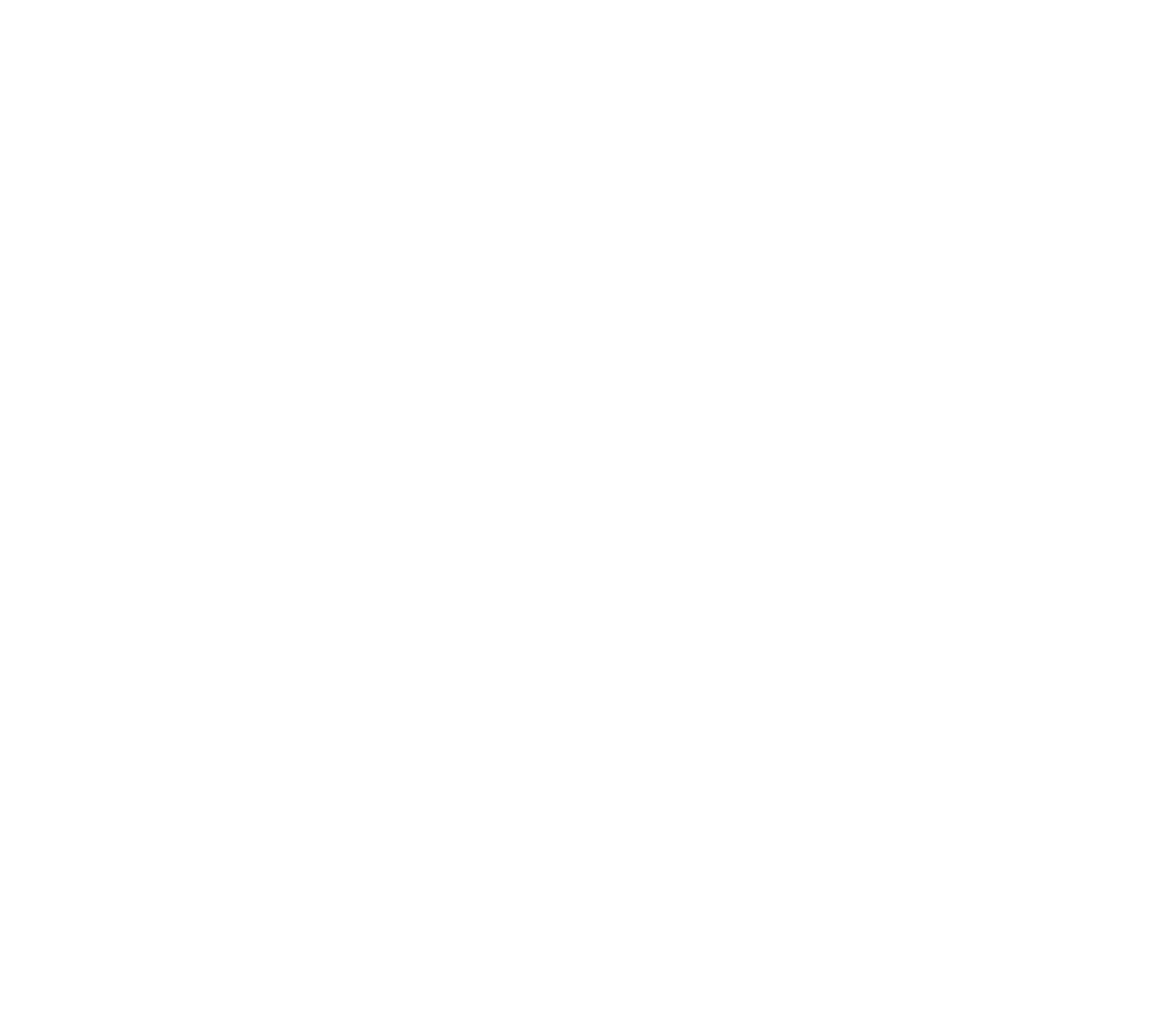Ein Monat ohne digitale Kommunikation
Ende letzten Jahres kam mir die Idee zu einem kleinen Experiment: Ich wollte meine Kommunikation im ersten Monat des neuen Jahres radikal verlangsamen, sie aus der virtuellen Welt heraus holen und ein Stück weit in jene Zeit reisen, bevor es Telegramme gab. Das bedeutet: keine Chats, keine Mails, kein Telefonieren – stattdessen nur noch Briefe oder persönliche Treffen. Ich erhoffte mir davon, zu spüren, wie sich Kommunikation in meinem Leben normalerweise auswirkt und welche Qualität von Kommunikation mir gut tut.
Das Experiment begann deutlich früher, als ich mir zuerst ausgemalt hatte. Zu erst brauchte es nämlich etwas Vorbereitung. Ich lebe ein Leben, das in Verbindung und Kontakt mir sehr vielen Menschen verläuft. Zusätzlich gehe einer Arbeit nach, die sowohl Kommunikation gestaltet als auch jede Menge digitale Kommunikation benötigt. Und dafür bin ich gleichermaßen dankbar. Die digitale Vernetzung und die unterschiedlichsten Kommunikationsmedien haben mir viele Jahre und bis heute ermöglicht, von überall aus zu arbeiten und auch auf langen Reisen in Kontakt mit verschiedenen sozialen Umfeldern zu bleiben. Ich war dabei – außer mal für 10-tägige Meditations-Retreats – eigentlich immer innerhalb weniger Stunden oder Tage erreichbar. Um mich für einen Monat aus den üblichen Kanälen raus zu ziehen, ohne dabei Auftraggebende zu verlieren oder große Irritationen oder Sorge bei Menschen auszulösen, beschloss ich, möglichst vielen dieser Menschen Bescheid zu sagen. Das war ein wenig Arbeit und Vorbereitung, funktionierte aber im Großen und Ganzen ganz gut.
Und dann kam der 31. Dezember, der letzte Tag der Kommunikation. Meine Kommunikations-Apps und -Programme am Laptop hatte ich bereits mittags vorsorglich geschlossen, sodass sie mir bei erneutem Öffnen oder Anschalten nicht entgegen schreien würden. Pünktlich kurz vor Mitternacht schaltete ich auch mein Telefon aus. Ich wusste es noch nicht, aber ich würde es die nächsten drei Tage nicht einmal in die Hand nehmen. Es gab also keine Neujahrswünsche oder -nachrichten außer von jenen, denen ich persönlich begegnete.
Am ersten Tag fühlte ich jede Menge Lücken in meinem Tag, die dadurch entstanden, dass ich all die Impulse bemerkte, in denen ich zu meinem Telefon greifen wollte, um zu sehen, ob mir jemand geschrieben hatte. Das waren wirklich viele Momente: wenn ich nach Hause kam oder mich auf den Weg irgendwohin machte, wenn ich von einer Tätigkeit zur nächsten wechselte und auch wenn ich zwischendurch mal Leerlauf hatte. Auch dachte ich immer wieder an bestimmte Menschen, denen ich etwas sagen oder die ich etwas fragen wollte, Termine, die ich gerne abstimmen würde oder wie es wohl dieser oder jener Freundin gerade ging. Auch fiel mir viel stärker auf, wie viel die Menschen, die mich umgaben, zwischendurch über ihre Handys kommunizierten. Ich empfand schon diesen ersten Tag als unfassbar friedlich und hatte das spontane Gefühl, nie wieder in den digitalen Kommunikations-Dschungel zurück zu wollen. Es war so viel stiller in mir.
Auch am zweiten Tag nahm ich das Handy nicht in die Hand. Ich hatte es mir zwar nicht verboten, das Handy für Navigation, Notizen, Aufgaben, Fotos, die Kalenderfunktion oder ähnliche Zwecke zu nutzen, aber ich brauchte es in dieser Zeit einfach nicht. Spontan verzichtete ich auch auf mein Navi, um mit dem Auto eine Route zu finden, die ich noch nicht kannte – und fand sie.
Ich verbrachte den Tag ruhig, mit Menschen vor Ort und nachmittags zu Hause. Ich schrieb meinen ersten Brief und fing nach zwei Seiten an zu weinen vor Glück. Ich war voll im Moment, im Hier und Jetzt, fühlte mich so sehr bei mir und so wenig verstreut in all den Chats und Mails, all den offenen Kommunikationsfäden und Dingen, an die ich denken wollte. Ich war einfach nur da und genoss die Langsamkeit, mit der ich mich der Verbindung durch den Brief widmete.
Den dritten Tag verbrachte ich fast komplett allein zu Hause, nur unterbrochen von einem Spaziergang in der Sonne. Ich schrieb den halben Tag und fühlte mich sehr ruhig und entspannt. Es gab allerdings eine Information, die ich aus einer E-Mail brauchte, welche ich mir vorher nicht raus gespeichert hatte, und dafür musste ich den Posteingang öffnen.
Ich schob dieses Event vor mir her und hatte Angst, meinen inneren Frieden damit zu brechen, aus Versehen E-Mails zu sehen, die ich gerade nicht sehen wollte oder mich zu konfrontieren mit Informationen, die mich aus der Ruhe bringen würden. Während ich mein Mailprogramm öffnete und das Programm noch am laden war, merkte ich, wie mein Nervensystem hochfuhr, mein Herz etwas schneller wurde. Es waren bereits 60 Mails in meinem Postfach – vermutlich eine Mischung aus Arbeit, verschiedensten Projekten, in denen ich aktiv bin, Newslettern, persönlichen Neujahrsgrüßen und Werbung oder Spam. Ich blieb zielstrebig bei der Information die ich suchte und schloss es sogleich wieder. Ein aufregender Ausflug, der mir bereits sehr viel spiegelte und schon nach zwei-einhalb Tagen verdeutlichte, was die bloße Anwesenheit der Kommunikationsflut mit einem entspannten System macht. Auch diesen dritten Tag blieb das Handy aus.
Ich werde ab nun versuchen, hin und wieder ein paar Beobachtungen festzuhalten.
Tag 7:
Gestern habe ich mein Handy einmal angeschaltet, um ein Foto auf meinen Rechner zu speichern. Nach wenigen Minuten habe ich es wieder ausgeschaltet. Erneut musste ich einmal an mein Mail-Postfach – 150 Mails mittlerweile. In den vergangenen Tagen hatte ich einen Brief und eine Nachricht in meinem Briefkasten und habe bereits mehrere längere Briefe verschickt.
Tag 16:
Ich liebe dieses Experiment – alles an ihm. Ich werde mir so vieler Dinge bewusst: Wie viel Zeit meines Lebens ich normalerweise in irgendwelchen Kurznachrichten verbringe, wie viele Menschen um mich herum kontinuierlich am Handy hängen, wie viel mehr Qualität in langsamer und persönlicher Kommunikation zu finden ist und wie tief die Sucht nach Dopamin und die daraus entstandenen Muster mir im Körper sitzen. Als ich mir eine Adresse aus einer SMS heraus suche und das SMS-Fenster danach schließe, schnellt mein Finger wie in einem Automatismus direkt als nächstes auf Telegram. Ich erschrecke mich fast ein wenig. Weder wollte ich Telegram öffnen, noch habe ich darüber nachgedacht. Und immer noch beobachte ich in den verschiedensten Situationen automatische Impulse, bei denen ich zum Handy greifen will: Wenn ich auf etwas oder jemanden warte, wenn mein Gegenüber den Raum verlässt, wenn ich den Raum wechsle, wenn ich mich auf den Weg mache oder irgendwo ankomme, wenn ich eine Pause mache – fast jede »Lücke« zwischen dem Tun scheint einen Handy-Check einzuladen. Es gibt schließlich immer irgendeine offene Unterhaltung oder neue Nachricht, auf die man in einer ruhigen Minute noch mal antworten wollte. Das ist sicherlich keine neue Erkenntnis. Und gleichzeitig fühle ich die Impulse dadurch, dass sie ins Leere laufen und stattdessen ein kleines Nichts entsteht, umso stärker.
Tag 17:
Ganz unabhängig von der Kommunikation merke ich, dass ich einen tiefen Frieden empfinde, je weniger Zeit ich mit digitalen Medien verbringe. Ich kann mich viel besser fühlen, kann meinen Körper besser fühlen und das, was mir gut tut. So gehe ich mehr spazieren als sonst und habe auch angefangen, abends eine kurze Yin-Yoga-Session vor dem Schlafengehen einzubauen – Zeit die ich sonst vielleicht mit Telefonieren oder Nachrichten-Schreiben verbringe.
Ein anderer Gewinn dieses Monats ist das Briefe-Schreiben.
Einen Brief zu schreiben, hat seine ganz eigene Magie. Ich nehme mir dafür Zeit, setze mich hin und denke darüber nach, was ich dem Menschen sagen will. Es dauert, bis der Brief sein Ziel erreicht und es dauert auch, bis eine vermeintliche Antwort mich erreicht – es macht also Sinn, sich auch Zeit für den Inhalt zu nehmen. Und ich stelle fest, dass es viele Menschen gibt, denen ich Dinge sagen möchte, die genau in dieser Langsamkeit zur Geltung kommen. Mal geht es um sehr emotionale Themen, um Konflikte oder Spannungen, um Traurigkeit oder um tiefe Freude, Liebe und Schönheit. Mal geht es um die Aufarbeitung der Vergangenheit, mal um die Perspektive für die Zukunft, mal auch einfach nur darum, mich so zu zeigen, wie ich gerade bin. Und ich genieße das Schreiben. Nicht nur, weil ich Schreiben an sich schon genieße, sondern weil ich mir Zeit nehme, das aufzuschreiben, das in der jeweiligen Beziehung wirklich gesagt werden möchte.
Tag 26:
Ich habe mich mittlerweile sehr daran gewöhnt, mein Handy die meiste Zeit des Tages ausgeschaltet in einer Schublade aufzubewahren. Es ist verrückt, für wie viele Dinge des alltäglichen Lebens – ganz abseits von Kommunikation – ich meine E-Mails und mein Handy sonst noch so benutze: Um irgendwo einen neuen Account anzulegen, um ein Passwort wiederherzustellen, um eine Überweisung zu machen, um eine Route zu navigieren oder ein Zugticket zu buchen.
Ich merke außerdem, dass auch die sozialen Medien Instagram, Facebook und CO mir so gar nicht fehlen. Zwar habe ich diese auch in den vergangenen Monaten ohnehin schon sehr selten geöffnet, in diesem Monat aber habe ich noch einmal gemerkt, wie sehr ich sie nicht brauche und wie unproblematisch und entspannend es sein kann, weniger von anderen Privatleben, Organisationen oder von der Welt mitzubekommen.
Tag 31:
Der vermeintlich letzte Tag dieses Experiments nähert sich dem Ende und er war voller gemischter Gefühle. Auf der einen Seite freue ich mich riesig darauf, morgen all die Nachrichten zu lesen, die in dem Monat in Form von Mails oder Nachrichten vermutlich aufgelaufen sind und die teilweise nun schon eine ganze Weile auf ihre Beantwortung warten. Ich habe Lust, mit Menschen zu kommunizieren, und ich habe einige Impulse für Nachrichten, Dinge, die ich organisieren möchte, Termine, die ich absprechen möchte. Da sind jede Menge Energie und eine Lebendigkeit in mir. Gleichzeitig ist da auch Angst. Angst, dass ich zurückfalle in die Muster, die ich mir über so viele Jahre unterbewusst angeeignet habe. Angst, dass ich mich unbemerkt direkt wieder anpasse an die schnelle Welt, an die hohen Text-Frequenzen und an die flacheren Gewässer des kurz angebundenen Austauschs. Und dann ist da natürlich eine Traurigkeit, dass diese Zeit, in der es so viel stiller war, sich nun ihrem Ende nähert.
Mein Wunsch ist es, die Dinge, die ich erkannt, die neuen Routinen, die ich genährt und den inneren Frieden, den ich erfahren durfte, auch mit und innerhalb der digitalen Kommunikation und Arbeit weiter zu kultivieren. Ich möchte achtsam sein mit der Errungenschaft des Abstands, den ich geschaffen habe, und dem Geschenk der erlebten Reduktion.
Mein kleines aber schwer wiegendes Fazit: Ich habe viel gelernt, wenig vermisst, mehr gespürt, eine große innere Präsenz erfahren und die Kommunikation zu mir selbst gestärkt. Und ich bin für so vieles in dieser kurzen Zeit dankbar: für all die Menschen, die diese vermeintlich verrückte Auseinandersetzung liebevoll mitgemacht haben, die spontanen Besuche, die ich empfangen durfte, die lieben Karten und den Brief, die ihren Weg zu mir gefunden haben, all die interessanten und bekräftigenden Gespräche, die ich zu diesem Thema in der Zeit hatte, und zuletzt für die Magie, die durch das Leben im Hier und Jetzt passiert.
Mir ist außerdem gerade sehr bewusst, dass das Experiment heute nicht vorbei geht, sondern dass nun die zweite und fast noch wichtigere Schwellenzeit folgt. Es ist die Zeit – ähnlich wie am Anfang –, in der ich den Kontrast spüre von dem einen Zustand zum anderen. Es ist aus meiner Sicht immer das Zurückkehren, dass mir vor Augen führt, wie ich mich auf einer Reise verändert habe. Und genau auf dieses Zurückkehren bin ich neugierig. Wie wird es sich anfühlen, die 700 Mails und die etlichen anderen Nachrichten zu lesen und zu beantworten? Mache ich das alles auf einmal oder Stück für Stück? Gehe ich direkt wieder in eine Geschwindigkeit oder mache ich langsame und kleine Schritte? Welche Konsequenzen ziehe ich aus meinen Erkenntnissen? Was darf gehen und was darf bleiben? Werde ich die Wahl meiner Kommunikationsmedien und die Frequenz, den Inhalt und die Art und Weise meiner Kommunikation nachhaltig verändern?
Es bleibt also noch eine Weile spannend – ich trage aber das Gefühl in mir, dass sich etwas in mir bewegt hat, das auch langfristige Auswirkungen auf mein Leben hat. Es fühlt sich ein bisschen an wie der Beginn einer neuen Zeit.