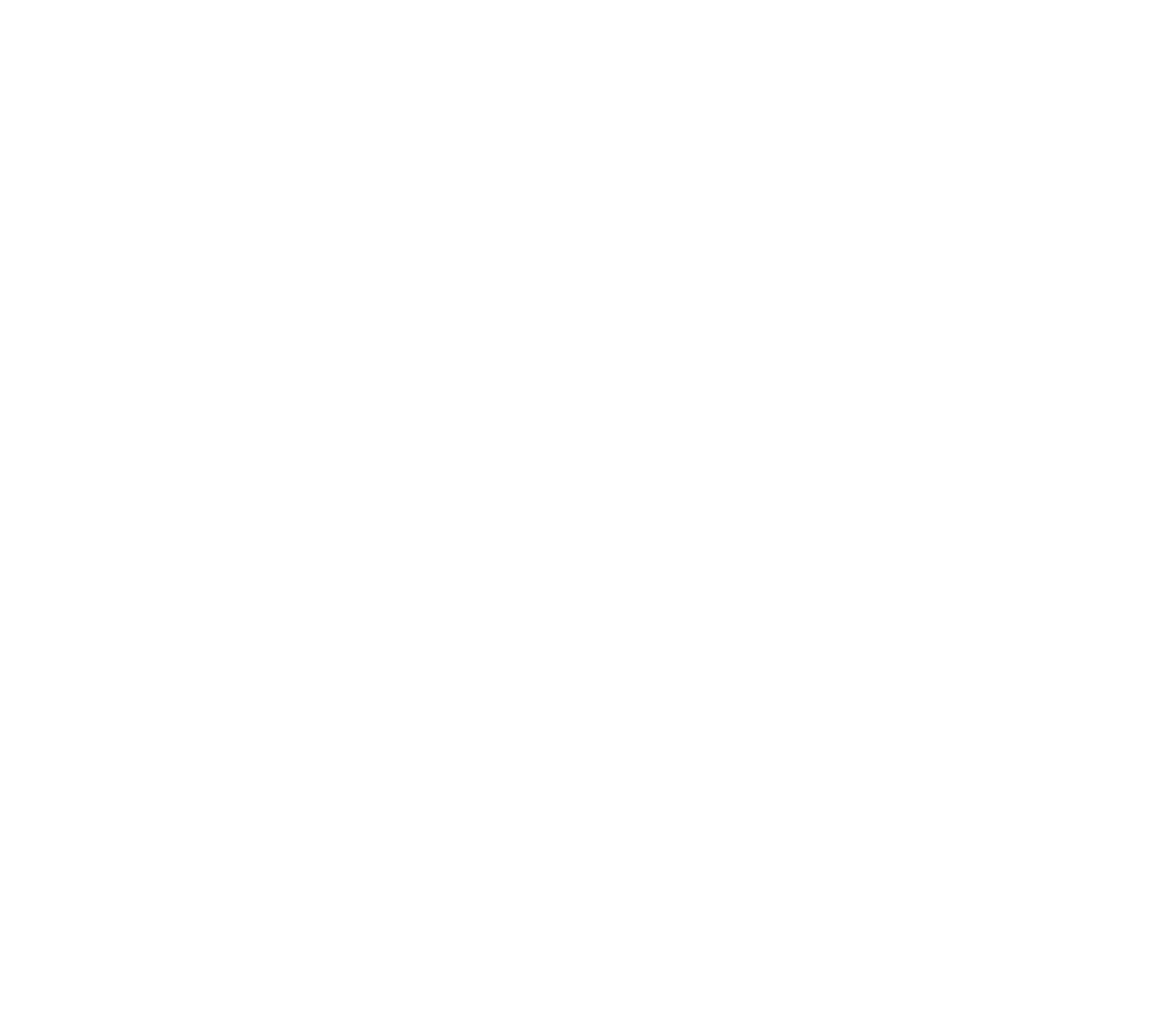Wo sind unsere alten Weisen und was wurde aus der Generationen-Symbiose?
Durch mein privates Umfeld werde ich gerade immer wieder daran erinnert, dass viele Menschen einsam sind – manchmal, obwohl sie ein großes soziales Umfeld haben, sich aber darin nicht verbunden fühlen, manchmal, weil sie einfach keine Menschen um sich haben.
Besonders fiel mir das kürzlich bei zwei älteren Menschen auf. Beide waren »Einzelbrödler«, über 80, jeweils geschieden oder getrennt lebend, zurückgezogen, kaum familiäre Kontakte. Es scheint mir zu erst so, als hätten sie kein Interesse an Menschen, als suchten und bräuchten sie die Einsamkeit. Im Kontakt und nach einer kurzen Auftauzeit zeigen sie sich allerdings aufgeschlossen und können gar nicht aufhören, aus ihren Leben zu erzählen – fast ein wenig so, als hätten sie all die Zeit, die sie alleine verbracht haben, darauf gewartet, dass endlich jemand kommt, um ihnen zuzuhören. Sie haben gemeinsam, dass sie sehr komplexe Persönlichkeiten sind, starke eigene Meinungen vertreten, sich Teilen der Gesellschaft abgewandt haben. Und ich möchte ihnen glauben, wenn sie sagen, dass sie es genau so wollen. Und gleichzeitig drängt sich mir beim Beobachten der Gedanke auf, dass auch sie sich tief im Inneren nach Verbindung sehnen. Ich nehme eigentlich an, dass alle Menschen das auf eine Art tun. Meine Vermutung ist, dass sie aus irgendeinem Grund nicht in die gesellschaftlichen Gefüge passten, ihnen Kompetenzen fehlten, verbundene Beziehungen aufzubauen, oder sie in ihren Leben voller Arbeit keine Kapazitäten frei hatten, ein soziales Netz zu weben. Vielleicht tragen sie auch emotionale oder seelische Wunden in sich, die ihnen Begegnung erschweren, haben schlechte Erfahrungen gemacht mit Menschen oder sind einfach nicht den richtigen Gegenübern begegnet. Heute fehlen ihnen nun vielleicht die Kontexte, in denen sie anderen begegnen, heute ist vielleicht die Hürde oder die Anstrengung zu hoch, neue Menschen kennenzulernen – oder sie haben resigniert und sich in ihre Einsamkeit gefügt.
Fakt ist: Menschen in ihrem Alter haben ein ganzes Leben gelebt. Sie haben teilweise stark bewegte Biografien und sind mitunter von Kriegen und Krisen geprägt. Sie sind durch verschiedenste politische, wirtschaftliche und teilweise geografischen Veränderungen gegangen, waren vielleicht verheiratet, vielleicht geschieden, haben Kinder bekommen und vielleicht auch verloren, sind gereist, haben gearbeitet, sich Häuser und Höfe und Leben aufgebaut. Sie haben einen Großteil ihres Lebens hinter sich und können zurückschauen und in einen sehr zeit-weiten Spiegel ihrer selbst blicken. Vielleicht haben sie einen größeren Erkenntnishorizont, vielleicht eine andere Ruhe und Gelassenheit in sich. Sie haben vielleicht Fragen gelebt und Antworten gefunden – und vielleicht ist in ihnen auch eine Weisheit erwachsen.
Natürlich bleibt das alles ein Vielleicht – denn jeder Mensch lebt ein anderes Leben. Nicht jeder alte Mensch hat all das erlebt, nicht jeder alte Mensch ist weise und auch hat Weisheit nicht zwingend etwas mit dem Alter zu tun. Gleichzeitig ist mir so, als wenn dieser Schatz von gelebter Lebenszeit von unserer Gesellschaft derzeitig nicht wirklich angemessen gehoben wird.
Es gibt sicherlich viele ältere Menschen, die in Familiensysteme oder Gemeinschaften eingebunden sind, dort mit ihrer Erfahrung wertgeschätzt werden und auch im Alter noch blühen können. Es gibt aber aus meiner Sicht auch einen nicht unerheblichen Anteil von alten Menschen, die eher vergessen scheinen – und nicht selten auch sich selbst vergessen. Überspitzt formuliert sitzen diese mit Gleichaltrigen in Pflegeheimen oder alleine in ihren Zimmern, Wohnungen und Häusern und warten darauf, dass das Leben irgendwann aufhört.
Mir ist wichtig, dass das nicht falsch verstanden wird: ich bin weder pauschal gegen das Alleine-Sein (im Gegenteil), noch gegen Pflegeheime, noch möchte ich Menschen kritisieren, die diese Institutionen für ihre Zugehörigen in Anspruch nehmen. Und trotzdem fühlt es sich für mich ein wenig so an, dass wir die Alten unserer Bevölkerung oft an den Rand setzen, statt sie in unserer Mitte zu integrieren.
Beruflich erbringen sie nicht mehr die Leistung, die es bräuchte. Sie sind eventuell weniger lernfähig, belastbar oder flexibel – und dann werden sie früher oder später »aussortiert«. Statt ermutigt zu werden, nach ihrer Neigung und in ihrem Maße weiter zu wirken, sich wirksam zu fühlen und so weiter teilzugeben und sich einzubringen, versinken Menschen irgendwann ab dem Renteneintritt oft schleichend in einem selbst-zentrierten Alltagstrott.
Persönlich finden wir sie mit zunehmendem Alter vielleicht wunderlich oder langweilig oder anstrengend oder grenzwertig. Vielleicht brauchen sie Pflege, Zeit und Raum, die wir nicht geben können. Vielleicht nehmen uns unsere eigenen schnellen Leben so voll und ganz ein, dass da kein Platz zu sein scheint für die Bedürfnisse, Langsamkeit oder Andersartigkeit einer alten Person. Wie auch im Kindesalter werden Menschen in einem höheren Alter auch wieder stärker fürsorge-bedürftig – ja manchmal ähneln sie Kinder sogar erschreckend stark in ihrem Verhalten oder ihren Bedürfnissen. Es braucht dann andere Menschen, die für sie Sorgen, ihnen Mahlzeiten zubereiten, sie in ihrer Körperpflege unterstützen, ihren Tag mit ihnen gestalten und ihnen eine möglichst hohe Selbstständigkeit ermöglichen. Wenn ich arbeite, selbst Kinder habe, selbst auf einer Ebene eingeschränkt bin oder andere Verpflichtungen habe, die mich einnehmen, kann ich all das selbstverständlich nicht leisten. Unsere gesellschaftlichen, politischen und auch wirtschaftlichen Strukturen machen es an vielen Stellen zum Drahtseilakt, diese Care-Arbeit in unserer Leben zu integrieren (ich kenne sogar Menschen, die darüber nachgedacht haben, keine Kinder zu bekommen, um stattdessen für ihre Eltern zu sorgen). Hinzu kommt, dass wir im Klein-Familienkonzept und in der Architektur unserer städtisch individualistischen Leben und Wohnräume teilweise gar keinen Platz mehr haben für die Großfamilie oder das Mehrgenerationen-Leben. Früher war es ganz normal, in größeren Gruppenverbänden zu leben und damit auch von den Stärken der unterschiedlichen Generationen zu profitieren: die Jüngeren geben ihre Energie und Unterstützung rein, die Älteren ihr Wissen und ihre Erfahrung – und das in einem bunten Spektrum von 1-100 Jahren. Aus meiner Sicht wohnt dem nicht nur Potenzial, sondern auch eine wahnsinnige Schönheit inne.
Natürlich muss die Verbindung zur älteren Generation gar nicht innerhalb unserer Familie stattfinden, sondern kann auch mit Fremden geschehen. Aber wenn ich mal kurz überlege: Wo in einem Durchschnittsleben berühren wir das Alter eigentlich? Alle paar Monate mal den Opa besuchen oder anrufen. Der älteren Person an der Kasse helfen, ihr Kleingeld aus dem Portemonnaie zu kramen. Die alte Frau auf der Bank mit den Tauben beobachten. Und das war’s dann auch schon wieder. Wo gibt es die Räume für Kontakt miteinander außerhalb von Familienfeiern, Pflichtbesuchen oder Zufallsbegegnungen? Wie sehr setzen wir uns ein für diese Menschen, die ihr ganzes Leben gelebt, geleistet und teilweise auch gelitten haben? Was braucht es in unseren Lebensstrukturen, damit wir sie statt als Belastung als die große Bereicherung sehen, die diese Menschen für uns sein können? Wie können wir die Verbindung wiederherstellen, die in der Kluft zwischen den Generationen verloren gegangen ist?
Im Moment kompensieren wir diese verlorene Verbindung oft in unserem Durst nach und Konsum von Wissen. Wir suchen Antworten und Sinn in unseren Leben, fragen uns, wie wir gute Entscheidungen treffen, unser Leben in den Griff bekommen und uns persönlich weiterentwickeln können. Wir buchen uns ein Seminar oder eine Ausbildung nach der nächsten – nicht selten bei Gleichaltrigen – und erhoffen uns dadurch vielleicht Orientierung und Sicherheit, die uns an anderer Stelle fehlt. Wir suchen Rat und Unterstützung bei künstlichen Intelligenzen statt bei den Dorfältesten unseres nicht vorhandenen Dorfes. Und wir absolvieren Online-Kurse, coachen uns alle gegenseitig und grünschnäblig mit irgendwelchen Techniken zum erfüllten Leben und versuchen dabei, Weisheit in den Warenkorb zu legen, statt diese im natürlichen Verlauf unseres Lebens erwachsen zu lassen. Ich will das keinesfalls pauschal verurteilen – aber doch einen kritischen Blick darauf werfen und mich fragen, wann wir uns eigentlich so sehr von unseren Wurzeln entfernt haben.
Auch hier möchte ich, dass das nicht falsch verstanden wird: Längst nicht alles an der älteren Generation ist gut. Je nach Kultur und Geschichte kann man definitiv sogar Gegenteiliges behaupten. Und alte Menschen sind nicht nur weise sondern definitiv manchmal auch stur, verschlossen, diskriminierend, rückwärtsgewandt oder resigniert. Alter ist kein Garant für konstruktive Ratschläge, gute Lehrende oder ethisches Handeln. Und Alter kann auch nicht immer gut mit den Herausforderungen der neuen Zeit umgehen. Man kann sicherlich noch viele Dinge sagen über das Alter, alte Menschen bewerten oder verurteilen, sie für die Vergangenheit verantwortlich machen oder für unsere Zukunft.
Ich möchte trotz alledem daran erinnern, dass Lebenserfahrung und generationsübergreifendes Lernen evolutionär gesehen uns allen als natürlicher Prozess innewohnt. Und wir können von ihnen nicht nur über das Leben lernen, sondern auch viel über das Sterben und über Verlust. Denn abgesehen von persönlichen Krisen gibt es wohl kaum einen Lebensabschnitt, in dem wir so viel loslassen müssen wie in diesem letzten. Und eines ist zumindest für einen Großteil von uns klar: irgendwann landen wir in dieser letzten Phase alle mal. Irgendwann werden wir alle alt.
Alles in allem glaube ich fest daran, dass wir Alter nicht als Defizit sondern als Ressource betrachten und diese wieder stärker in unsere Leben integrieren sollten. Ich frage mich: Wie würde eine Welt aussehen, in der wir nebeneinander leben und uns gegenseitig nähren? Was könnten wir alles bewirken, wenn wir nicht alle Fehler der vorherigen Generationen wiederholen, sondern ihnen zuhören und aus ihren Fehlern lernen würden? Wie viel altes Wissen und vergessene Weisheiten könnten wir erhalten, wenn wir es uns von den Alten überreichen ließen und es dadurch am Leben hielten? Und wie viel mehr Lebensqualität, Würde und Selbstwirksamkeit würden diese Menschen erfahren, wenn wir ihnen öfter in einer demütigen und integrierenden Haltung begegneten?
Ich rufe dazu auf, uns diese Fragen eindringlich zu stellen, ihnen nachzugehen und Antworten der Fürsorge und Teilhabe zu finden. Ich wünsche mir, dass wir die Welt, unseren Alltag und unsere Umgebung mit Augen und Herzen untersuchen, die offen sind für all jene, die von den Falten und dem Reichtum des Lebens gezeichnet sind. Ich wünsche mir mehr Wachsamkeit, Engagement und Zeit, diesen Menschen zu begegnen und in einen Dialog zu gehen – ganz gleich wie groß der Altersunterschied sein mag. Lasst uns diese Verbindung wieder kultivieren – wir brauchen sie mehr denn je an unserer Seite.