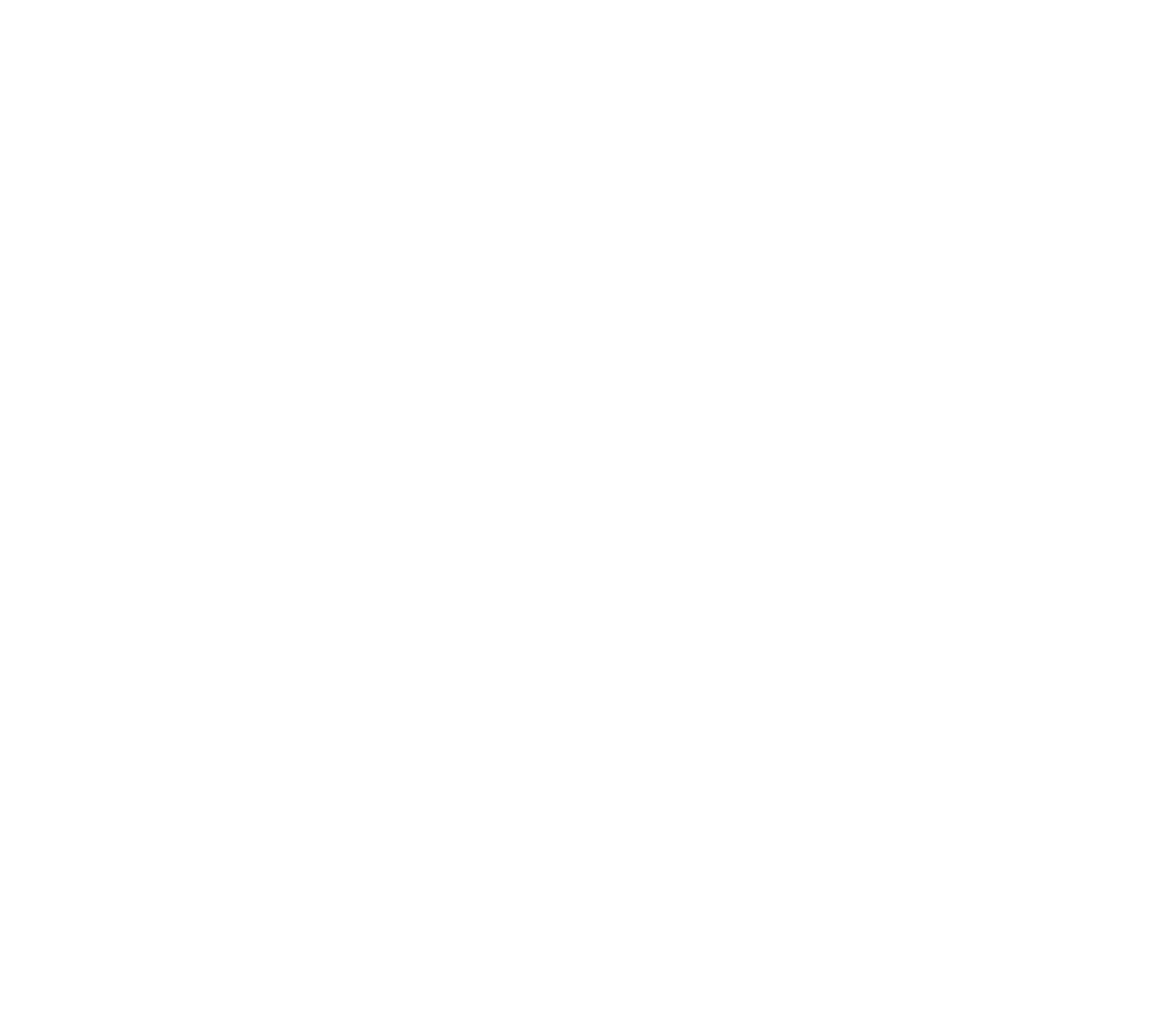Der Nabel nach Hause oder was vom Reisen übrigbleibt
Ich bin nun schon ein kleines Weilchen unterwegs – nicht viel länger als bei einem gewöhnlichen Urlaub, aber lange genug, um Whatsapp-Texte, Sprachnachrichten und Mails zu bekommen von Menschen, die sich nach mir erkundigen. Das ist ja in keinem Fall etwas Schlechtes, sondern ganz im Gegenteil ein Zeichen von Anteilnahme und menschlicher Nähe. Ich freue mich, die Stimmen meiner Lieben zu hören, Fotos von zu Hause zu sehen und/oder Geschichten, Storys oder eine Bitte um Rat gesendet zu bekommen. Ich weiß das zu schätzen – ich liebe die Menschen, die mich umgeben.
Trotzdem beschäftigt mich dieser Nabel nach Hause natürlich. Wenn man früher man etwas weiter weg war, war die einzige Möglichkeit, die Menschen in seiner Heimat zu erreichen, ihnen einen Brief zu schreiben oder sie anzurufen. Das klingt ja erst einmal unfassbar drastisch, hat allerdings einen unschlagbaren Vorteil: Man war damals noch »richtig« weg. Um heute eine derartige Isolation zu erreichen, führt eigentlich kein Weg daran vorbei, sein Smartphone oder jegliche andere technische oder mit dem Internet verbindende Geräte zu Hause zu lassen. Wenn wir heute weg gehen, bleiben irgendwie trotzdem da. Und da beginnt das Paradox, das einen Reisenden in den Wahnsinn treiben kann – eigentlich uns alle täglich in den Wahnsinn treibt: Wir befinden uns automatisch an mehreren Orten gleichzeitig. Das „im Hier und Jetzt leben“ bekommt eine ganz neue Bedeutung und Komplexität, wenn es ein anderes Hier und Jetzt ist, als jenes, das wir unseren Alltag nennen. Ich möchte wirklich keine Moralpredigten zu dem ganzen Thema halten. Wir wissen das alles ja eigentlich alle. Wir tun eben nur nichts dagegen. Mal nicht up-to-date zu sein, nicht über alles Bescheid zu wissen und nicht ebenso alles von uns zu teilen, scheint in unserer Wissensgesellschaft der absolute Killer.
Ich habe kürzlich mit einem Filmproduzenten gesprochen, der für ein Unternehmen, Videos von Touristentouren dreht. Er erzählte mir, dass er ab und zu nur so tue, als wenn er filme, weil es Momente gibt, die er gerne für sich behält und nicht mit anderen teilen mag. Das klingt im ersten Moment egoistisch, ist aber meiner Meinung nach genau das Gegenteil. Manchmal müssen wir an uns selbst denken, und manchmal gibt es Dinge, die einzig und allein uns gehören und nicht geteilt werden müssen.
So kann »Sharing« eben auch »Not Caring« bedeuten: Wenn wir uns nur noch darauf versteifen, alles mitzunehmen und dem Rest der Welt zu zeigen, vergessen wir, uns um den Moment zu scheren, uns um uns selbst zu kümmern.
Und manche Dinge kann man eben auch gar nicht teilen. Es ist meistens schier unmöglich, einen Moment in einem Bild festzuhalten. Wir können zwar versuchen, die Landschaft aufzunehmen, einen Menschen abzubilden, eine bestimmet Lichtstimmung einzufangen oder ein Video zu drehen. Das was wir spüren, wenn wir einatmen und die Luft riechen, was wir spüren, wenn wir über die Oberfläche von warmen Holz streichen, durch weißen Sand gehen, einen Menschen berühren, mit dem wir eine Geschichte teilen oder an was wir denken, wenn wir die Augen schließen – das gehört nur uns und kann uns mit keinem Bild der Welt genommen werden.
Ich möchte aber noch einmal zurück kommen auf die Form des Reiseberichtes. Wie kann und/oder will ich meine Reise für mich, meine Lieben und den Rest der Welt festhalten? »Ich«, »meine Lieben« und »der Rest der Welt« unterscheiden sich dabei ja schon einmal im Grundsatz. Natürlich müssen Familie und Co, wissen, wo ich in etwa bin und dass es mir gut geht – das ist aber in Zeiten unserer krassen Verkabelung/Vernabelung kein großes Kunststück und bedarf keiner weiteren Gedanken. Das betrifft ja auch mehr das „Ich bin jetzt hier oder dort.“ oder das „Es geht mir gut.“.
Wie ist es aber mit einer nachhaltigeren langfristigeren Art der Erzählung? Ich könnte für mich selbst ein privates Tagebuch führen, so wie zum Beispiel das Textdokument, in dem ich gerade schreibe. Ich könnte meine Erlebnisse und Erfahrungen auch mit allen anderen teilen – etwas anderes ist ein Weblog („Blog“) ja schließlich nicht. Ich könnte es auch auf die spitze treiben und einen Vlog drehen und mein Erlebtes für meine Mitmenschen so noch greifbarer und nacherlebbarer darstellen. Das Problem ist nur, dass ich eigentlich gar keine Lust habe, meine Welt den halben Tag nur durch die Kamera wahrzunehmen und die andere Hälfte des Tages damit zu verbringen, das abgedrehte Material zu bearbeiten, zu schneiden und mit fancy Youtuber-Musik zu hinterlegen. Ich bin auch nicht die, die sich jeden Tag einmal vor die Kamera setzt und was von ihren Erlebnissen erzählt. Vielleicht wird das noch – jeder ändert mal seine Meinung und noch ist nicht aller Tage Abend. Das Problem ist aber, dass ich mich selbst nicht unbedingt gerne reden höre, geschweige denn auf einem Bildschirm sehen mag.
Aber sind wir mal ehrlich: Muss aus allem, was wir als Menschen von uns geben oder produzieren immer und immer wieder ein Gewinn gezogen werden– sei es Geld, Anerkennung oder das bloße »Weiterkommen«? Können wir nicht einfach mal etwas tun, um es zu tun?
Ich fühle mich beim Schreiben gerade so. Ich fühle mich, als würde ich einen Tisch bauen, meine Arbeitskraft, meine Fähigkeiten und meinen Schweiß hineinstecken und ihn dann auf die Straße stellen und sagen: Lasst uns daran speisen oder darauf Karten spielen oder sonst etwas tun, das uns gemeinsam Freude bereitet. Ich sage gar nicht, dass ich hier einen hervorragenden Tisch baue oder das er schön ist oder einzigartig oder sonst was. Es ist der Tisch, der er ist und ich möchte ihn teilen, fertig aus. Und wenn ich schließlich allein an ihm sitze, werde ich in irgendeiner Form eine hervorragende Zeit mit ihm haben.
So viel zu Kommunikation, Reiseberichten und Tischen. Bis zum nächsten Gedankenauflauf, Swanni