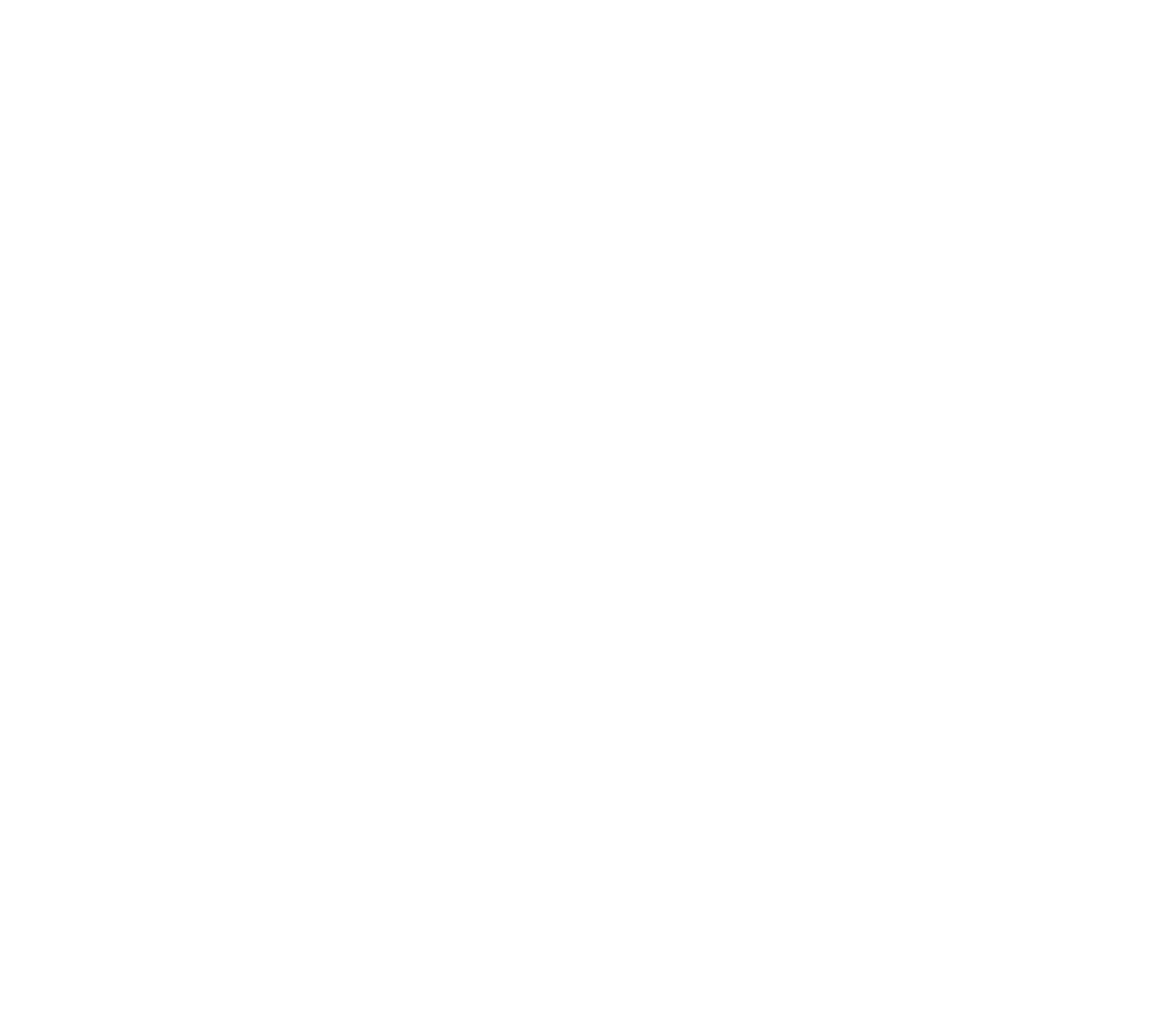Eine Reise durch die Wirklichkeit
Ich sitze in einem Zug zwischen den Welten. Und ich betrachte meine Umgebung und stelle fest, dass ich meine Aufmerksamkeit auf ganz verschiedene Dinge legen kann, ohne dabei den Blick abzuwenden.
Ich kann zum Beispiel auf die Fensterscheibe schauen und den Fokus meiner Betrachtung auf unterschiedliche Ebenen richten. Wenn mich die Menschen um mich herum anschauen, sehen sie mich nur, wie ich auf die Scheibe starre. Doch in mir durchlaufe ich verschiedenste Welten.
Ich kann natürlich zu erst einmal einfach aus dem Fenster schauen. Und dort kann ich auf den Horizont blicken, in die Ferne, in der alles nur sehr langsam »vorbei« zieht. Oder ich kann die Dinge betrachten, die mir und dem Zug nah sind und in Windeseile – in der Geschwindigkeit des Zuges – an mir vorbei rauschen. Meine Augen »springen« dabei und versuchen, immer wieder neue Dinge zu fokussieren, solange bis wir zu schnell sind und alles verschwimmt. Der Moment, in dem man zu schnell wird und alles verschwimmt, ist unangenehm und tut ein bisschen weh.
Das lässt sich wohl auch gut aufs Leben übertragen.
Und dann schaue ich etwas anderes an. Irgendwas beliebiges zwischen dem Zug und dem Horizont. Dort draußen ist eine ganze Welt. Und nach einer Weile abstrahiert sich das Bild und ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich mich durch die Welt bewege oder an einer Welt vorbei oder ob die Welt sich an mir vorbei bewegt.
Es wird langsam dunkel draußen.
Je dunkler es wird, desto besser kann ich mein eigenes Spiegelbild sehen. Ich betrachte es lange. Ich betrachte es so, wie ich es noch nie betrachtet habe. Ich schaue mir in die Augen und stelle fest, dass es die Augen sind, mit denen ich es gerade ansehe. Ein verrückter Gedanke. Was wäre, wenn »ich« im Spiegelbild stecken würde, bzw. sich mein Bewusstsein auf das Spiegelbild übertragen würde? Würde das für meine Wahrnehmung überhaupt einen Unterschied machen? Der Gedanke einer Bewusstseins-Spiegelung macht mich nach einer Zeit etwas unruhig und ich kehre zurück zu dem bloßen Spiegelbild meines Körpers.
Ich sehe neben meinem Spiegelbild auch noch das des Mannes, der mir gegenüber sitzt. Er sitzt dort schon die ganze Zeit. Und er scheint neugierig zu sein, mich aber nicht direkt ansehen zu wollen. So starrt auch er auf die Scheibe. Und zwischendurch sieht er mich mal an. Jedoch nicht mich, die ich vor ihm sitze, sondern mein Spiegelbild. Und wenn ich sein Spiegelbild und seine Augen in der Scheibe anschaue, treffen sich unsere Blicke und wir haben »Augenkontakt« – in einer anderen Welt. Denn wir schauen uns nicht in die Augen. Wir schauen uns quasi ins Spiegelbild.
Dann löse ich mich aus diesem Kontakt und wandere mit meinem Blick auf der Reflexion meiner Scheibe weiter in die Tiefe des Raumes. Dort sehe ich hinter mir die vier Sitze auf der anderen Seite des Ganges. Auf einem von ihnen sitzt ein Mann. Er arbeitet an seinem Laptop und ich kann erahnen, dass er etwas schreibt oder programmiert. Dann tippt er etwas in sein Handy, dann schreibt er weiter auf dem Laptop. Zu ihm haben sich zwei weitere Menschen gesetzt und sie reden in einer mir fremden Sprache miteinander und zeigen sich gegenseitig Dinge auf ihren Smartphones. Sie sitzen Knie an Knie mit dem Mann mit dem Laptop und seine platzsparende Haltung lässt in mir die Frage erwachsen, ob er wohl morgen Rückenschmerzen haben wird.
Ich möchte noch einen Schritt weiter gehen. Denn auch hinter ihnen befindet sich ein Fenster, das ich in der Spiegelung meines Fensters erkennen kann. Eine Scheibe, durch die ich einen weiteren Horizont sehen kann und ebenso Dinge, die dicht an ihr vorbei rauschen. Und auch in ihr sehe ich wieder Spiegelungen. Ich sehe in der Spiegelung meines Fensters die Spiegelung des Fensters hinter mir. Und die Spiegelung des Fensters hinter mir zeigt mich von hinten wie ich in die andere Richtung auf meine Scheibe blicke. Ich sehe mich also dabei an, wie ich mich ansehe. Es fühlt sich ein bisschen an, wie im Kreis zu gucken.
Und dann kann ich natürlich auch noch die Scheibe selbst betrachten.
Sie ist dreckig und mit einigen Fingerabdrücken versehen. Es sieht aus, als hätte hier vor nicht allzu langer Zeit ein Kind gesessen und auf Dinge gezeigt, die am Fenster vorbeiziehen – nur um dann festzustellen, dass es sie nicht anfassen kann, weil dort eine kalte durchsichtige Scheibe im Weg ist. Jede Berührung dieser unsichtbaren Wand hat Spuren auf ihr hinterlassen. Würde es wohl merken, wenn dort keine wirkliche Landschaft vorbeiziehen würde sondern ein Film von einer Landschaft? Können wir den Unterschied wirklich ausmachen, solange dort eine Scheibe zwischen uns ist, die verhindert, dass wir die Dinge berühren?
Plötzlich läuft eine Fliege an den Fingerabdrücken vorbei und lässt mich erkennen, dass die Scheibe für sie ungeachtet der Schwerkraft gerade der Boden ist, auf dem sie läuft. Ich versuche, gedanklich die Perspektive der Fliege einzunehmen. Wie verwirrend es sein muss, unter seinen eigenen Füßen auf eine Welt zu blicken, die unter dem »Boden«, der Glasscheibe, an einem vorbeirauscht. Man sähe den Horizont in der Tiefe unter sich. Mir vorzustellen, wie Himmel und Erde, »oben und unten« aus dieser Perspektive wirken müssen, sprengt meine Vorstellungskraft. Je nach dem, in welche Richtung ich blicke, würde es wie ein landschaftliches Fließband von vorne nach hinten oder von hinten nach vorne unter meinen Füßen langlaufen. Ein schwindelerregendes Gefühl. Doch die Fliege sieht das sehr wahrscheinlich so wie so ganz anders, weil ihre Augen andere sind und somit ihre Wahrnehmung eine andere ist und wahrscheinlich die geistige Verarbeitung dieser komplett anders abläuft.
Auch der Mann, der mir gegenübersitzt, beobachtet die Fliege. Vielleicht denkt er das gleiche. Oder er ekelt sich. Oder er denkt über ihre Sterblichkeit nach. Oder seine eigene. Oder er denkt gar nicht.
Natürlich kann ich nun auch noch alles betrachten, was sich zwischen mir und der Scheibe im inneren des Zuges befindet, bis hin zu meinem eigenen Körper, meiner eigenen Hand – bis hin zu meiner eigenen Nasenspitze.
Und das bringt mich zu einer weiteren physischen Ebene, die es zu betrachten gibt. Auf meiner Nase sitzt nämlich noch meine Brille. Und wenn ich mich gut anstrenge, kann ich in der Innenseite meines Brillenglases mein eigenes Auge sehen. Ich kann auch bei dieser Scheibe feststellen, dass sie Fingerabdrücke besitzt oder dreckig ist. Und sie ist von einer besonderen Form und besitzt scheinbar magische Kräfte. Sie entscheidet nämlich darüber, ob ich den Horizont oder meine eigene Hand überhaupt sehen kann. Sie befähigt meine Augen zu arbeiten. Sie verändert, was ich sehe oder wie ich wahrnehme. Sie könnte die Welt um mich herum schärfen und verunschärfen, sie einfärben oder abdunkeln. Auch diese Beobachtung lässt sich aufs Leben übertragen, welches wir alle durch unsere ganz individuell eingestellten geistigen Brillen betrachten.
Der Gedanke des Brillenglases bringt mich zu meiner eigenen Linse, welche Licht durchlässt und ein Bild auf meine Netzhaut wirft, welches mein Gehirn dann verarbeiten kann. Ich kann diese Linse allerdings nicht sehen. Genau so, wie ich mein Auge nicht sehen kann. Und da passiert ein großer Klick-Moment: Ich kann mein Auge nicht sehen, weil es das ist, was sieht. Und ich frage mich: Ist es so auch mit dem Selbst? Kann ich es nicht erkennen, weil es das ist, was erkennt? Und kann ich es deshalb ähnlich wie mein Auge nur als Spiegelung in anderen erkennen?
Ich springe aus dieser abstrakten Gedankenebene zurück ins physische Hier und Jetzt. Ich schaue mich um und frage mich, welche Gedanken die anderen Menschen hier gerade haben mögen, welche Ebenen sie wahrnehmen und welche Scheiben sie betrachten. Die meisten blicken offenbar auf die Scheibe ihres Smartphones und in die horizontlose Welt dahinter.
Und dann frage ich mich, was Scheiben überhaupt für uns bedeuten und wie faszinierend Glas doch ist. Es ist transparent, durchsichtig, fast so, als gäbe es vor, gar nicht da zu sein. Es schützt uns einerseits und ist uns zugleich eine Grenze, die uns trennt. Mal lässt es Licht und unseren Blick durch und mal wirft es ihn zu uns zurück. Und dann sehen wir Dinge, wie zum Beispiel unsere eigenen Augen oder uns selbst von hinten – Dinge, die wir sonst nie im Stande wären zu betrachten. Und wenn wir uns dieser Wirkung von Glas und Reflexion bewusst sind, eröffnet es uns die Möglichkeit einer Abgrenzung von innen und außen und das Wahrnehmen einer Tiefe, die physisch eigentlich gar nicht da ist. Wir können die Reflexion nutzen als Multiplikator parallel existierender Ebenen oder Realitäten. Und wenn wir dies bis zum Ende denken, macht es uns dieses Element so nicht auch möglich, Unendlichkeit zu visualisieren? So wie man es zum Beispiel von zwei sich gegenüberliegenden Spiegeln kennt?
Ich bin fast ein wenig erschöpft von den Sprüngen zwischen all diesen Ebenen. Ich merke, dass meine Wahrnehmungs-Kapazität eine Grenze hat. Und ich kann mir gut vorstellen, dass manche Menschen sich irgendwo zwischen diesen Wirklichkeiten verlieren.
Ich beschließe, zurück zum Anfang zu gehen und aus dem Fenster zu schauen.
Wir stehen mittlerweile an einem Bahnhof. Draußen auf dem anderen Gleis steht ein anderer Zug. In ihm auf meiner Höhe sitzt eine Frau, die aus dem Fenster sieht. Und in dem Vierer hinter ihr ein Mann, der auf der anderen Seite aus dem Fenster sieht beziehungsweise auf die Scheibe schaut. Und ich sehe sein Spiegelbild auf jener Scheibe. Und ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht schauen wir uns gerade in die Augen.
Mir kommt ein Gedanke. Ich drehe mich um und schaue auf die Fensterscheibe hinter mir. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber ich kann sogar in der Spiegelung dieser Scheibe den anderen Zug sehen. Und, wenn ich genau hinsehe, erkenne ich auch jenen Mann und sein Spiegelbild, welches er betrachtet.
Ich bin fasziniert. Wenn er wüsste, was ich hier gerade tue, könnten wir uns »in die Augen« schauen, obwohl wir einander abgewandt in zwei unterschiedlichen Zügen sitzen.
Nichts ist unmöglich.