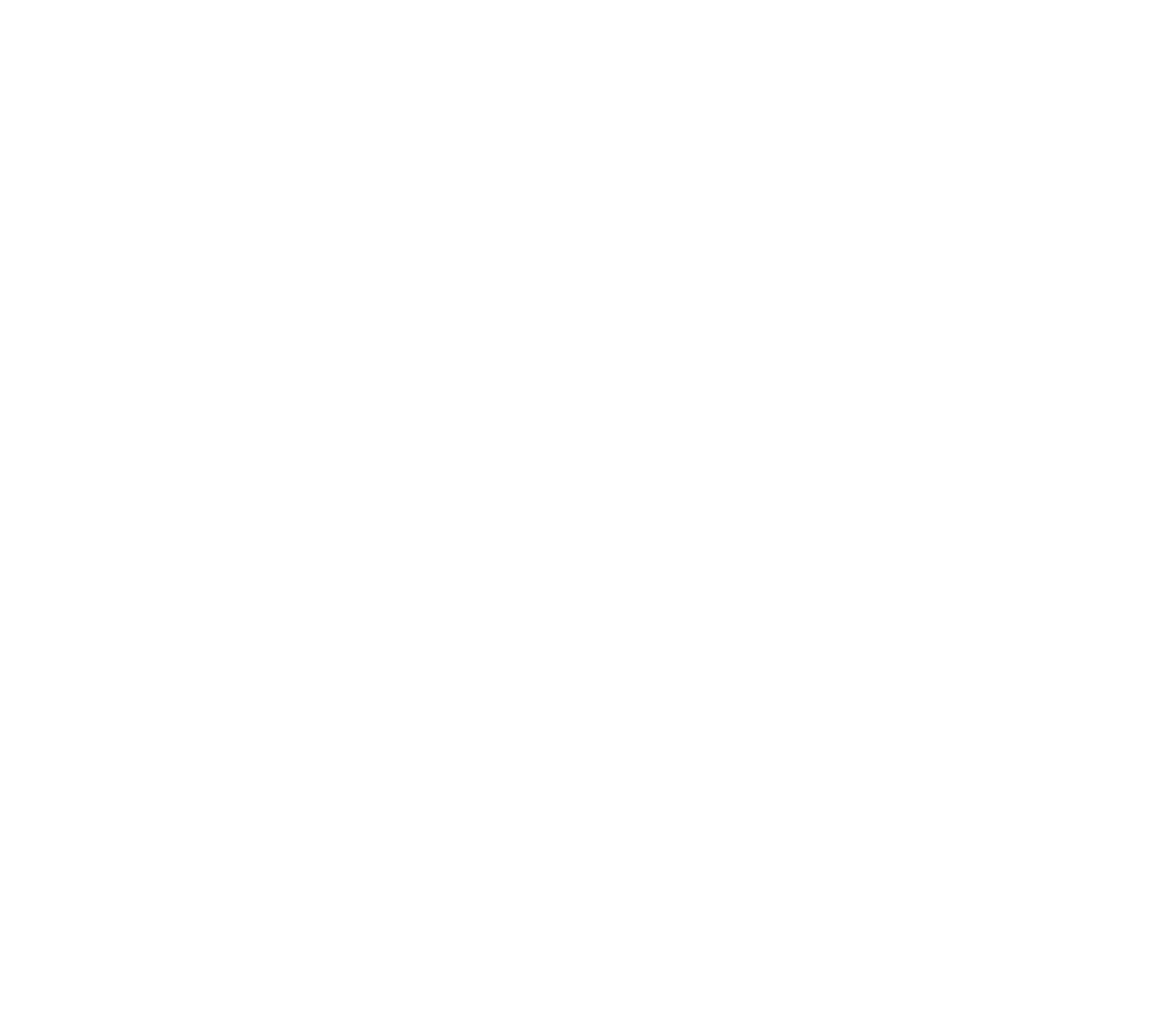Zwischen Meditation und Masturbation
Zugegeben, der Titel ist direkt und mag polarisieren. Aber seit einiger Zeit fasziniert mich etwas an dem Spannungsfeld zwischen diesen beiden. Irgendetwas steckt darin, das vielleicht weder mit dem einen noch mit dem anderen unbedingt etwas zu tun hat. Ich möchte mir ein paar Fragen stellen und sie als Ausgangspunkt und Projektionsfläche nutzen. Aber wie komme ich gerade auf diese zwei?
Einer der ersten Gedankenanstöße zu diesem Thema war ein Freund, der mir von einem Facebook-Post erzählte. In dem Post rief eine Frau andere Frauen dazu auf, weniger zu meditieren und stattdessen zu masturbieren, um ihre Lust wieder zu finden. Die These hinter diesem Aufruf also vielleicht: Meditation nimmt uns die Lust. Auch meine persönliche Erfahrung ist, dass in längeren Phasen von sehr intensiver regelmäßiger Meditation die sexuelle Lust abnehmen kann. Besteht da wirklich ein Zusammenhang? Und ist es andersherum das gleiche? Sind wir durch regelmäßige Masturbation unausgeglichener?
Sind diese zwei Aktivitäten wie Pole, die sich gegenseitig ausschließen? Oder teilen diese Aktivitäten auch Eigenschaften miteinander? Können sie einander vielleicht sogar ergänzen oder ausgleichen – oder sind sie vielleicht auf eine Art sogar gleich?
Kann Masturbation Meditation sein?
Und kann Meditation Masturbation sein?
*
Ich kenne sowohl Menschen, die in ihrer täglichen Morgenroutine meditieren, als auch Menschen, die jeden Morgen mit Masturbation beginnen. Welche Auswirkungen hat das wohl auf unseren Tag? Welche Qualitäten bringen die beiden in unser Leben?
Das ist wahrscheinlich so unterschiedlich wie die Menschen selbst. Und auch auf die Gefahr hin zu verallgemeinern würde ich zu erst einmal sagen: Beide können mich in den Körper bringen und beide können mich mit mir selbst verbinden. Mit beiden kann ich mir auf einer Art etwas »Gutes« tun. Genau so kann ich wahrscheinlich beide als eine Kompensation oder Flucht nutzen. Und doch scheinen sie nach meinem Verständnis im Wesen etwas Gegensätzliches zu verkörpern: Das eine folgt einem starken Bedürfnis nach Befriedigung (ich reagiere auf das Bedürfnis), das andere hilft mir, Bedürfnisse wahrzunehmen, zu beobachten und ihnen mit Gleichmut begegnen.
Aber was macht Letzteres mit dem Bedürfnis? Verschwindet ein Bedürfnis, wenn ich es nur lange genug ignoriere? Oder es einfach nur beobachte? Oder bleibt es solange am Leben, bis es gehört und bedient wird – vielleicht im Verborgenen? Erhöht sich durch die Befriedigung die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder kommt?
Und was bedeutet der Begriff der Befriedigung? Man könnte ihn zum einen so deuten, dass etwas in Unfrieden ist, was eine Be-friedigung benötigt. Zum anderen wirft er bei mir die Frage auf: Braucht es die Befriedigung, um in Frieden zu sein? Bringt sie wirklich Frieden oder nicht vielleicht sogar das Gegenteil? Weckt sie nicht vielleicht einfach den Wunsch nach mehr? Und ist es nicht das, worum es auch bei der Sucht geht?
*
Ich lasse die Fragen mal im Raum stehen und komme noch einmal kurz zurück zur Erregung.
Bei der Erregung muss es ja zu erst einmal gar nicht um etwas Sexuelles gehen. Wenn wir uns an dieser Stelle einmal von der sexuellen Erregung und ihrem Höhepunkt lösen, gibt es ja auch noch reichlich andere Themen oder Gefühle, bei denen ich intensive innere Regung spüren kann. Neben der Lust hätten wir da zum Beispiel noch Euphorie, ein Aufgebracht-Sein, Panik oder jede beliebige Form von Drama. Was sie gemeinsam haben, ist die Intensität. Es geht um einen Rausch oder Kick, das Zusteuern auf einen Höhepunkt oder einfach einen extremen Zustand. Je öfter oder stärker ich mich in diesen Zustand versetze, desto mehr gewöhne ich mich an den Reiz. Und desto stärker, höher, extremer muss der nächste Reiz oder die nächste Erfahrung vielleicht sein, damit ich wieder einen Höhepunkt empfinden kann.
Für mich sind sie in unserer Gesellschaft unübersehbar: »höher, schneller, weiter«, Rekorde, Weltreisen, Extrem-Sportarten, Ayahuasca-Zeremonien – die Liste könnte eine ganze Weile so weiter gehen.
Und auf der anderen Seite: Sind Stillstand und Gleichmut nicht genauso Extreme? Ist das radikale Negieren von Höhepunkten nicht selbst eine Art Höhepunkt?
Ich stelle mir Gleichmut oft als eine Linie vor, die ohne starke Ausschläge in der Mitte zwischen den »positiven Extremen«, die nach oben ausschlagen, und den »negativen Extremen«, die nach unten ausschlagen, relativ gerade und gleichmäßig verläuft. Wenn ich stattdessen jedoch nicht eine Skala mit der Bewertung von negativen und positiven Extremwerten betrachte, sondern die Skala aus den beiden Energien selbst bestünde, wird alles, was extrem schwingt oder stark in Bewegung ist, der eine Pol und alles, was ruhig oder regungslos ist, der andere. Damit wäre Gleichmut nicht mehr der Mittelwert, sondern selbst ein Pol.
Für einen Menschen, der energetisch die ganze Zeit unter Starkstrom steht, könnten Meditation, Stille und Reizarmut also zur absoluten Grenzerfahrung werden. Und vielleicht hat sie mit der oft umschriebenen »Erleuchtung« wahrscheinlich auch so etwas wie einen orgasmischen spirituellen Höhepunkt.
*
Warum aber suchen wir Höhepunkte? Was geben sie uns, wenn wir sie erreichen?
Ich stelle mir einen Orgasmus vor, einen Jubel-Schrei beim Erreichen eines Berggipfels, den Fall-Schirmsprung aus einem Flugzeug.. – sie lassen Botenstoffe durch meinen Körper fließen, lösen extreme körperliche Erfahrungen aus und beleben mich. Worte, die mir da kommen, sind wach, elektrisiert, bewegt, euphorisch, lebendig.
Sind es also erst die Höhepunkte, die uns uns lebendig fühlen lassen? Auch auf unserer Pulslinie ist jeder Schlag des Herzens ein kleiner Höhepunkt, der anzeigt, dass wir leben. Nun sorgt ein normal schlagendes Herz nicht unbedingt für das Gefühl von einem »Kick«. Diesen haben wir erst, wenn es »höher schlägt«, schneller schlägt, wilder schlägt und unser Körper Hormone aussendet – erst in der Steigerung wird es interessant.
Die Frage könnte also viel mehr lauten: Wie extrem muss ein Gefühl sein, damit ich diese Lebendigkeit empfinde?
Oder aber: Wie feinfühlig muss ich sein, damit ich auch die kleinen Regungen intensiv spüren kann? Was wäre, wenn ich es darauf anlegte, die Höhepunkte nicht dadurch zu finden, dass ich mich oder mein Handeln steigere, um wieder mehr zu spüren, sondern dadurch, dass ich mich wieder für niedrigere Reize sensibilisiere? Was passiert, wenn ich die Skala ändere? Wenn ich Geschwindigkeit und Größe verwandle in etwas Stilles, Zartes, Achtsames, Bewusstes? Könnte dann nicht jeder kleinste Etappen-Erfolg, jede Berührung mit der Fingerspitze, jeder Tropfen Morgentau, jeder Atemzug ein Feuerwerk sein?
Ich hinterlasse diese wie auch die zahlreichen weiteren Fragen hier im Raum – im Raum zwischen Meditation und Masturbation. Und ich überlasse es jeder und jedem Einzelnen, sie zu durchdenken und zu reflektieren, sie zu drehen und zu wenden und alles in und zwischen ihnen zu erforschen – in der Stille oder der Ekstase oder wo auch immer Antworten verborgen liegen mögen.