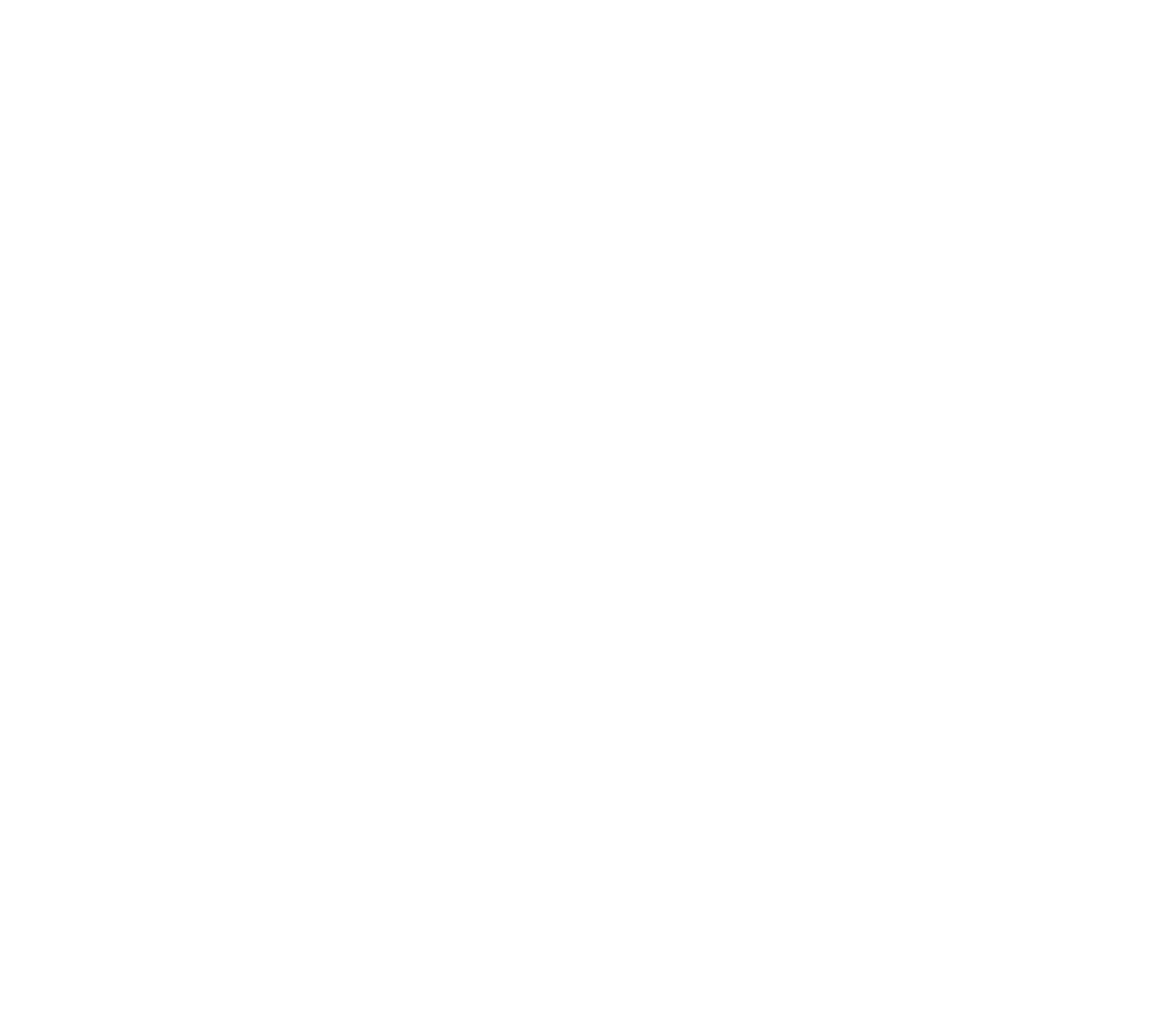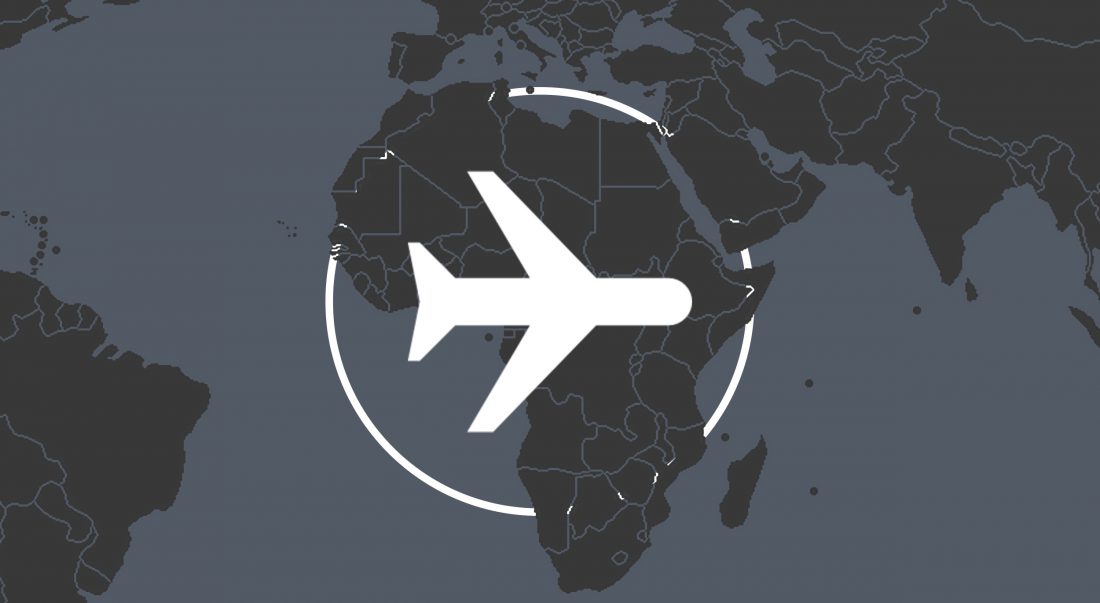Kapstadt – das südlichste Europa der Welt
Bei all den erkenntnisreichen Ergüssen, die mir während meiner Reise aus den Fingern fließen, komme ich nicht umhin auch mal einen kleinen etwas klassischeren Reisebericht einzuschieben. Ich habe Südafrika abgeschlossen und möchte dieses Land nicht einfach unbeschrieben zurück lassen.
Vorweg muss ich schon mal gestehen, dass ich nicht wirklich von Südafrika schreiben kann. Ich kann von Kapstadt, dem kleinen eigenen Europa am südlichen Zipfel des Landes, und von der Garden Route – doch zu dieser vielleicht an anderer Stelle mehr. Das Folgende kann allen, die bereits in Cape Town waren, ein lächelndes Zurückerinnern bescheren und allen, die noch dort hin wollen einen netten ersten Vorgeschmack geben.
Kapstadt ist eine vibrierende funkelnde Metropole mit so vielen Gesichtern, wie es Dinge zu erleben gibt. Ich möchte die Reisetipps kurz halten und nur kurz und knackig anreißen, was euch dort erwartet. Wie gerade schon angedeutet: Glaubt nicht, dass ihr dort „Afrika“ zu spüren bekommt. Natürlich könnt ihr bunte Armbänder, hölzerne Giraffenfiguren oder farbenfrohe Gewänder kaufen, aber ihr werdet hier nicht auf einem Elefanten reiten, mit den Löwen schlafen oder euch durch den Dschungel schlagen. Es gibt hier genauso Konzerte, Hipsterviertel, Szene Cafés und allen anderen Klimm-Bimm, den es in jeder anderen Stadt von Welt auch gibt. Auch Kapstadt hat dunkle Ecken und fröhliche Ecken und teure Ecken und hektische Ecken. Auch Kapstadt hat Berufsverkehr, bei dem gar nichts mehr geht, und Mietpreise, denen man beim steigen quasi zusehen kann – wie das ist einer Metropole eben so ist.
Was diese Stadt aber so besonders macht, ist die Kombination von Rundum-Meer und den Bergen in der Mitte. Die südafrikanische Sonne brennt im Sommer (unserem Winter) kräftig einen weg, während der South-Eastern-Wind (Cape-Doctor) einem vom Meer die ersehnte Abkühlung bringt.
Die Kapstädter, örtlich „Capetonians“ genannt, sind überspitzt gesagt eine Mischung aus schwarz, weiß, Südafrikaner, Holländern und Deutschen. Gesprochen wird Englisch, Xhosa oder Afrikaans – und da gibt es dann noch ein paar sprachliche Eigenheiten, wie zum Beispiel, Fragen mit einem „hey?“ zu beenden oder zur Verblüffung ein „Joh!“ oder „Jissis!“ auszustoßen.
Wir befinden uns hier außerdem in einem Land, in dem Kontraste zwischen arm und reich oder weiß und schwarz größer gar nicht sein könnten. Südafrikas Geschichte der Apartheid spiegelt sich natürlich auch hier wieder und so kann man am einen Ende der Stadt die teuersten Luxusvillen bewundern, am anderen Ende Townships mit Wellblechhütten vorfinden, die sich in einem scheinbar gewollten Chaos über große Fläche erstrecken.
Schauen wir doch noch einmal was Kapstadt denn nun so zu bieten hat. Ich gehe dabei jetzt mal nach Bezirken vor – diese sind überspitzt formuliert folgende:
Obz aka Observatory ist Studentenbezirk und wird von den meisten besser betuchten eher als „dodgy“ beschrieben, hat aber mit seinen Second-Hand-Läden, Restaurants und Cafés auf der Lower Main Road jede Menge Charme. Es grenzt an den Devilspeak, einen besonders anstrengend (!) zu besteigenden Ausläufer des Tafelberges.
In Woodstock geht das kreative Leben ab: Biscuit Mill Market, Design Studios, Ausstellungen, Start-Ups.
Es folgen etwas weiter nördlich Milnerton, Sunset Beach, Table View, Blouberg – endloser wunderschöner Strand, der an Nordsee und Dänemark erinnert, mit bestem Blick auf Kapstadt City und den Tafelberg (als absoluter Kite-Surfing Strand bekannt).
Zurück in Kapstadt: das Stadtzentrum. Im Schutze des Tafelberges wandert man durch Long-Street (bei Tag Touri-Meile, bei Nacht Party-Meile), Loop-Street, Bree Street und Green Market (Geheimtipp „First Thursday“ mit freiem Eintritt in Galerien, kostenlosem Wein und jeder Menge feierfreudiger Menschen). Außerdem zu finden: Tambourskloof, Bo-Kaap, Civic Center, Bahnhof und Minibus-Anlaufstelle.
Nächstes Highlight – V&A Waterfront und der Hafenbereich: Schicki-Micki-Shoppen, Sehen und Gesehen-Werden, seine Yacht ausführen, zu Silvester Feuerwerk gucken oder einfach teuer essen gehen. Von hier aus kann man auch ein Boot Richtung Robben Island nehmen (frühere Gefängnisinsel, auf der Nelson Mandela lange Zeit verbrachte).
Weiter an der Küste entlang folgen Greenpoint, Seepoint, Clifton und schließlich Camps Bay, welche in dieser Reihenfolge auch steigende Grundstückspreise, Einkommen und Egos vorweisen. Lange Promenaden mit Grünanlagen, Alibi-Joggern oder Sonnuntergangs-Spaziergängern. Auch hier zu Hause sind Leuchtturm, Greenpark und das WM-Stadion. Clifton lädt zu einem Tag an Beach 1-4 und eiskaltem Wasser ein, Camps Bay trumpft auf mit feinen Restaurants, einem abendlichen Glas Wein mit den Schönen und Reichen oder dem Sonntag-Abend im Café Caprice (egal was man hier unternimmt, man wird auf jeden Fall Geld los).
Weiter geht’s mit Hout Bay, einem kleinen Fischer-Hafen, mit feinem weißen Sandstrand, jeder Menge Seehunden und einem atemberaubenden Wochenendmarkt in der Markthalle. Eine ganz eigene Welt bildet die Peninsula: Touri-Programm pur. Ein sehr schöner Nationalpark, mit dem süd-westlichsten Punkt Afrikas, Pinguine zum Anfassen und kleinen süßen Orten wir Simons Town oder Fish Hoek. Vorbei an Kalkbay folgt dann Muizenberg, die Surferhochburg mit den kleinen bunten Umkleidehäuschen. Von hier aus könnte man dann am Township Khayelitsha vorbei Richtung Strand fahren, einer kleinen Stadt in der False Bay (hier hat das Wasser dann auch endlich Badetemperatur). Alternativ dazu ein Tripp nach Stellenbosch – Weinhochburg, sehr schnieke und nett mit dem angrenzenden ebenso zauberhaften Franchoek. Will man es noch weiter treiben, macht man sich von hier auf die Route 44 und erreicht irgendwann Bettys Bay und schließlich Hermanus die Wal-Stadt, in der (hauptsächlich zwischen Juni und Oktober) jede Menge Wale zu sehen sind.
Das wars dann auch schon mit der kurzen, leicht verspäteten Zusammenfassung von Kapstadt und Umgebung. Ein kleiner Text wird dieser pulsierenden Metropole sicher nicht ganz gerecht und auch muss ich detailliertere Tipps und Erläuterungen aussparen – ich stehe euch aber jederzeit für Fragen bereit.
Ich habe die einzelnen Facetten und vor allem aber die Menschen, die ich in dort kennen lernen durfte, sehr geschätzt und behalte sie in warmer guter Erinnerung in der südlichsten Ecke meines Reiseherzens.