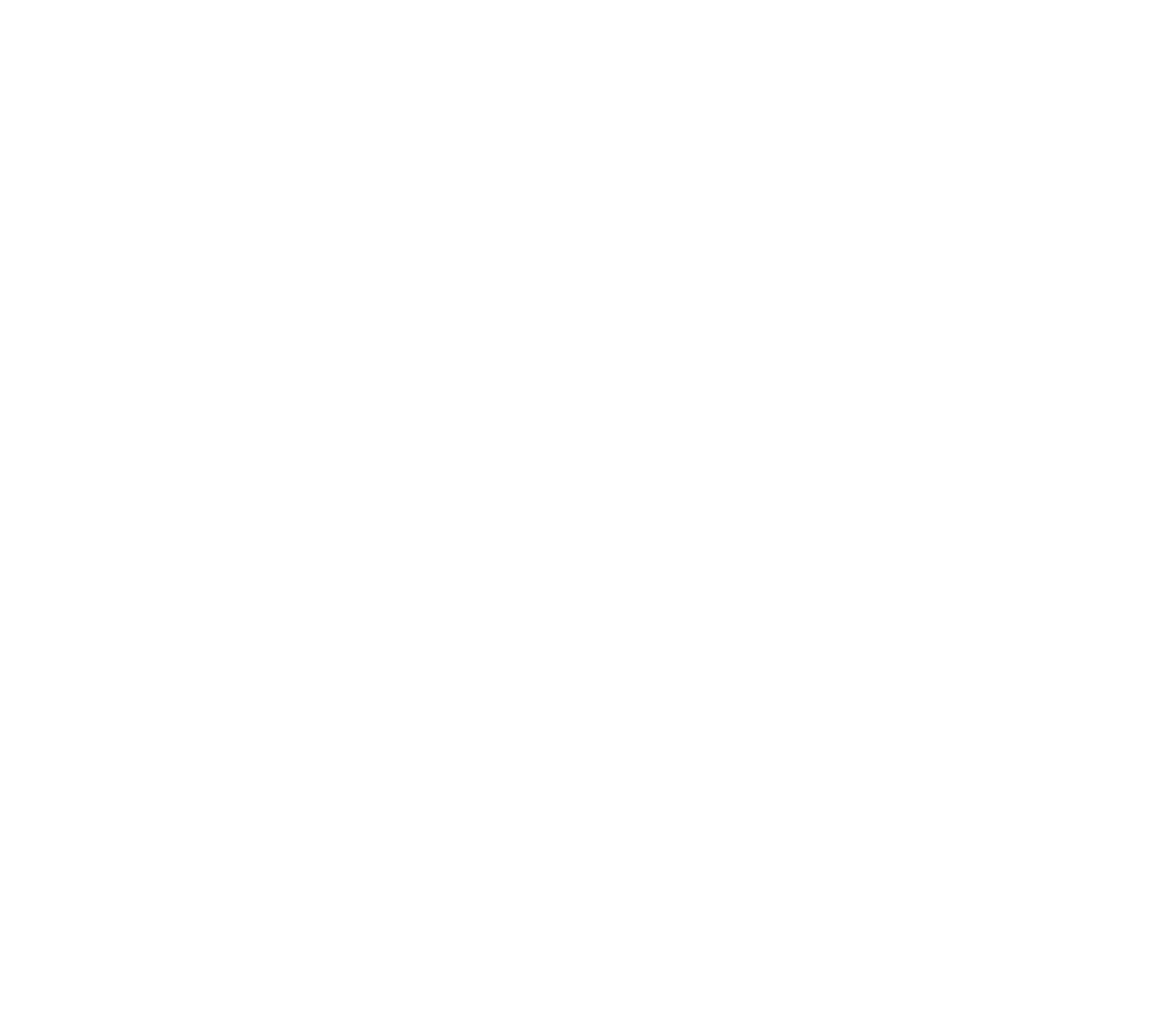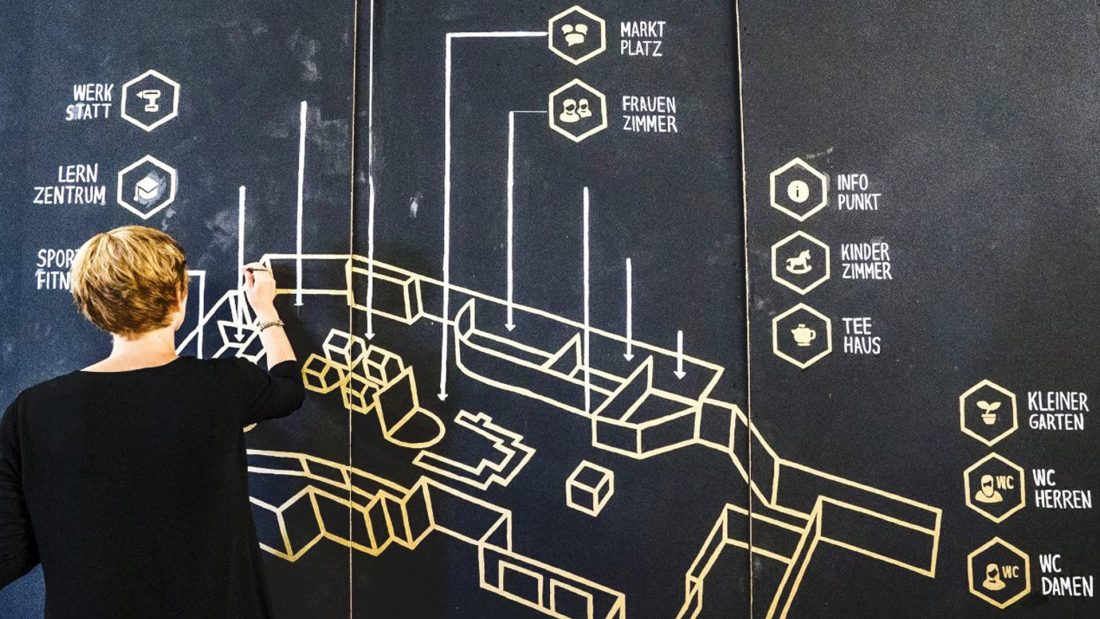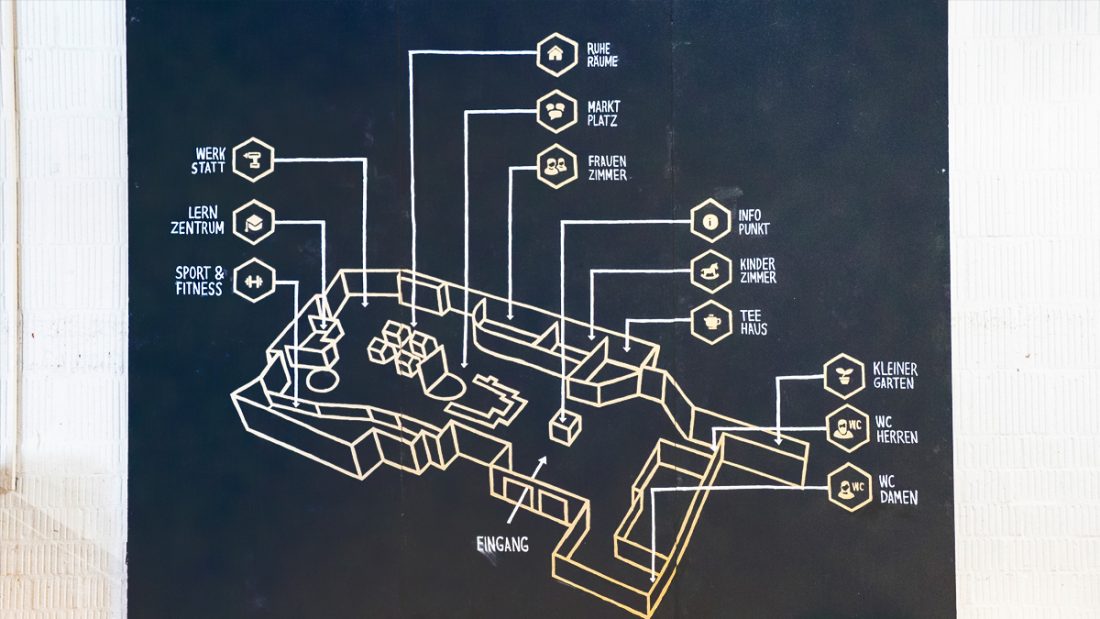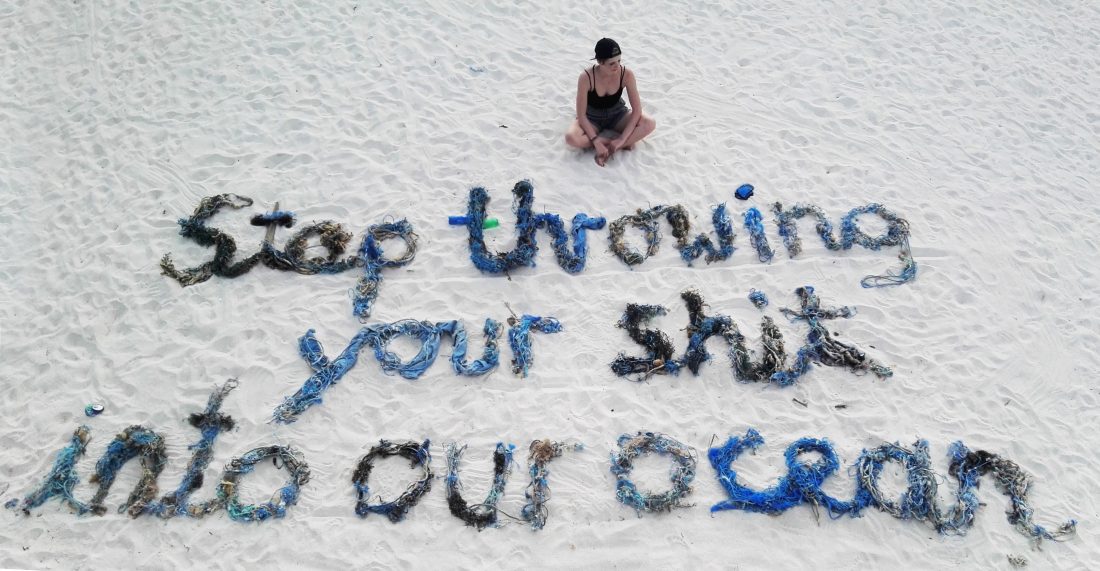Die Entdeckung des Universums unterm Apfelbaum
Auf der Suche nach Schatten und einer Pause von den scharfen Strahlen der gleißenden Sonne fand ich einen Baum. Sie stand dort einfach so, voller Ruhe und Gelassenheit, ihre Äste über Jahre in alle Richtungen streckend. Ihre Zweige, schwer von den neugeborenen Früchten, hingen herab und bildeten einen schützenden Schirm, ein Zelt, einen neuen Himmel rund um mich herum. Wie ein Vorhang, der den Rest der Welt verbirgt. Wie eine Grenze, die dieser Baum zieht, als würde sie sagen: »Dies ist alles, was du an Welt gerade brauchst.«
Und so akzeptiere ich ihre Welt für diesen Moment als meine und setze mich nieder. Sie lässt gerade so viel Licht durch, wie ich es brauche – genug Helligkeit und Wärme, ohne zu verbrennen oder zu schwitzen.
Ich bin am Boden – in einem wunderbaren Sinne. Ich sitze auf dem Boden, auf dem Gras, dem Moos, all den kleinen Pflanzen und Wesen.
Ich fange an, genauer hinzusehen. So viele verschiedene Arten von Gewächsen.
Dann, während ich jeden Halm und jedes Blatt für sich betrachte, finde ich auf einmal eine unfassbare Weite. Es sind so viele. Mir wird plötzlich bewusst, dass ich, während ich hier sitze, wahrscheinlich eine ganze Menge von ihnen zerdrücken muss. Ich setze mich ein Stück zur Seite und sehe, dass mein Körper einen Abdruck hinterlassen hat. Oh weh. Eben war diese Wiese für mich noch ein Boden, jetzt scheint sie mir wie ein Wald – den ich zerdrückt habe.
Ich beobachte, wie jeder einzelne Grashalm sich wieder aufrichtet. Einer nach dem anderen zurückspringt in seiner ursprüngliche Form. Mir wird bewusst, wie viel Kraft es sie kosten muss. Und dann wird mir bewusst, dass jeder dieser Halme und Moos-Stränge und jedes kleine Pflänzchen die Kraft aufgewendet hat, aus einem Samen in der Erde an die Oberfläche zu stoßen und heranzuwachsen, um sich dann auszubreiten und zu vermehren. Ich betrachte die Gewächse noch etwas näher und sehe die vielen kleinen liebevollen Details, mit denen sie versehen sind. Da sind einige Blätter, die Härchen haben, einige mit winzig kleinen Stacheln und manche stehen da mit einer Blüte und tragen so einen kleinen Farbklecks. Ich sehe sattes Grün genau so wie einige vertrocknete Halme. Und dann sehe ich eine Ameise. Und eine kleine Spinne. Und daneben eine Assel. Und dann eine Spinne, die nur noch den Bruchteil der Größe der anderen Spinne hat. Um diese wirklich in ihrer Gestalt zu erkennen, bräuchte ich ein Vergrößerungsglas. Und plötzlich sehe ich, dass sich alles in meinem Sichtfeld bewegt.
Überall krabbelt und wuselt es. Da sind minuziöse Spinnennetze und eine Straße von Ameisen, die an meinem Bein vorbeiläuft. Eine der Ameisen überwindet mein Bein – als sei es nur ein Zweig, der zufällig im Weg liegt, fast so, als wäre mein Bein dort schon immer gewesen. Eine weitere Ameise tut es ihr nach. Ich merke ein Kribbeln an meinem Arm. Ein winziger Käfer kämpft sich durch meine Arm-Behaarung und hat dabei sichtbare Schwierigkeiten, voran zu kommen. An meinem Oberschenkel schaut ein weiteres kleines Getier um die Ecke. Dann eine weitere Ameise. Und dann scheinen sie überall.
Mein Körper und meine Kleidung sind hier und da mit kleinen Lebewesen bedeckt. Sie sind bei mir, weil ich bei ihnen bin. Ich habe mich hier in oder besser auf ihren Wald gesetzt. Habe mich in ihre Welt gesetzt. Bin ein Teil von ihr geworden. Wie ein Ast oder ein Stein oder Stamm oder Tier oder sonstiges, das in der Natur einen Teil ihrer Welt bildet und erkundet und erklommen wird.
Manche krabbeln über mich, manche landen auf mir und fliegen dann wieder fort. Ich frage mich, ob es sie wohl interessiert, dass ich da bin bzw. ob es für sie einen Unterschied macht, ob sie sich durch die Grashalme kämpfen oder durch meine Armbehaarung. Und dann wird mir bewusst, dass dies für viele größere Tiere, die in der Natur leben, ganz normal ist. Anderes kleines Getier lebt auf ihnen und mit ihnen. Sie sind quasi dauerhaft besetzt und Lebensraum für andere Tiere.
Während ich eine unfassbar kleine Spinne dabei beobachte, wie sie über meine Haut krabbelt, stelle ich fest, dass es wahrscheinlich irgendwie ähnlich unter meiner Haut aussieht und in mir drin. Denn dort fließt mein Blut und dort sitzen Zellen und Bakterien. Und alles bewegt sich und arbeitet und es laufen Prozesse ab, die mich so funktionieren lassen, wie ich es tue. Alles fließt und krabbelt und wächst.
Und meine Haaren scheinen mir plötzlich wie das Gras, auf dem ich sitze, und meine Arme und Beine wie die Äste, die der Baum über mir ausstreckt.
Ich rette eine kleine Fliege aus meinem Tee und beobachte sie dabei, wie sie ihre Beine sortiert und versucht, such von der Flüssigkeit zu befreien.
Ich lege mich hin. Und mir ist so bewusst, wie viel Fläche mein Körper gerade einnehmen muss, wie viel Welt ich gerade unter mir zerdrücke. Aber diese Welt wird damit klarkommen. Ich bin ein Teil von ihr und ich kann nicht auf dieser Welt sein, ohne auf ihr zu sein. Jeder natürliche Untergrund ist voller Leben. Und solange mir keine Flügel wachsen (und selbst dann müsste ich irgendwann landen) komme ich da nicht drum herum. Wahrscheinlich ist vieles von diesem Leben unter mir so klein, dass es von mir gar nicht gestört wird sondern einfach so weiterlebt.
Und unter der Oberfläche geht es dann ja auch noch weiter: die Wurzeln von all dem Gras und den Pflänzchen und die Wurzeln von größeren Pflanzen, kleine Käfer, Spinnen, Regenwürmer, »große Kolosse« wie Wühlmäuse oder Maulwürfe. Und wie tief es erst unter mir weitergeht. All diese Erdschichten. Mein Geist kann diese Vorstellung gar nicht vollziehen oder greifen.
Es ist eine merkwürdige Vorstellung, hier zu liegen und von »Tiefe unter mir« zu sprechen. Ich schwimme schließlich nicht auf dem Meer, sondern liege auf festem Boden. Und doch scheint es mir, so weit, wie ich mich von Größe und Relation getrennt habe, unter mir liege ein Raum, weit, groß, unendlich und sich meiner Vorstellungskraft entziehend. Ein Universum. Ein Universum unterm Apfelbaum.
Ach ja, der Apfelbaum. Ich habe sie für einen Moment fast vergessen. Wie weit in die Tiefe ihre Wurzeln wohl ragen? Sie steht so fest und sicher im Erdreich und sie sieht aus, als wenn es ihr gut ginge. Als sei sie zufrieden. Und dann lege ich eine Hand an ihren Stamm.
Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber es passiert erst mal nichts. Ich spüre ihre Rinde. Und irgendwann spüre ich meinen eigenen Puls. Mein Blut, wie es durch mich strömt. Und ich stelle mir vor, was unter ihrer Rinde ist, ähnlich wie ich mir vorgestellt habe, was unter oder in meiner Haut passiert. Und ich stelle mir die gleichen Zell-Prozesse vor, ganz viele kleine sich bewegende Teilchen.
Die Prozesse, die in ihr ablaufen und sie wachsen lassen, sie Blätter, Blüten und Früchte tragen lassen. Und je mehr und länger ich über diese kleinen Teilchen und die Teilchen in den Teilchen nachdenke, desto größer, weiter, tiefer wird der Raum, den ich mir unter der Rinde vorstelle.
Und dann wird mir bewusst, dass der Baum und auch ich das gleiche Universum in uns haben, das ich unter dem Gras erahnt habe, das sich unter mir im Meer auftun würde und über mir im Himmel. Es ist genauso in mir und nach innen wie um mich herum und in allem, was mich umgibt.
Ich habe ein bisschen das Gefühl, innen und außen lösten sich auf. Als gäbe es kein Innen und Außen mehr sondern nur noch eins und den Abstand oder den Fokus, mit dem ich es betrachte. Die Perspektive, aus der ich beobachte. Und vor allem aber das Bewusstsein, mit dem ich es tue.
Denn wenn ich mir all diese Dinge nicht bewusst mache, dann sitze ich einfach nur im Schatten und schreibe einen Text.
Und genau damit werde ich jetzt aufhören.